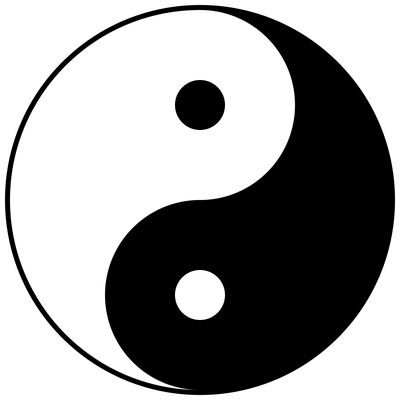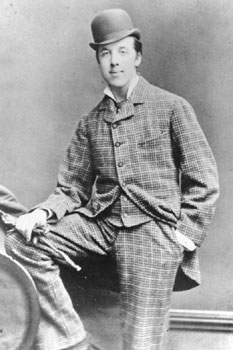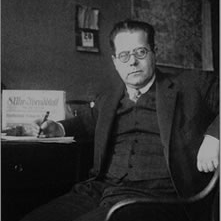Schnipsel 171: Die Sucht der Träumer
Fotos v.l.n.r.: Traum auf Elba, (c) Stefan Scheffler; Wolf Maahn fotografiert von Martin Schumann: Wolf Maahn - Haldern Pop Festival 2017-5 (CC BY-SA 4.0); aus der Tradition der amerikanischen Ureinwohner ein Filter für die falschen Träume ... (c) Stefan Scheffler.
Fatalerweise werden Menschen zum falschen Zeitpunkt nach ihrem zukünftigen Berufswunsch gefragt. Jetzt mit IL Jahren kenne ich ihn: Berater für Träumerei, elitären Anarchismus und brotlose Künste, Spezialgebiet Ästhetik. Das Träumen zuzulassen, es in seinem mächtigen Potential zur Verbesserung der Welt zu sehen, sich dem unbefangenen Idealismus hinzugeben, ohne Rücksicht auf die Grantler und Bewahrer des Unzureichenden nehmen zu wollen, gehört zum Jungsein. Der unverbrauchte Glaube an die Möglichkeit des Verändern-Könnens ist ein hohes Gut, das man jedem Menschen mit Aussicht auf ein ganzes zukünftiges Leben nur wünschen kann, damit er späterhin keine Reue empfinden muss, es nie gefühlt zu haben. Und deshalb braucht der Idealismus der frühen Jahre ihre Sänger des Lobpreisens, ihre Energiegeber für Aufsässigkeit, Neuorientierung, vielleicht auch mahnende Abkehr - Supertramp sang "Dreamer", Wolf Maahns Album hieß 1986 "Rosen im Asphalt". Sein späterer Song "Die Sucht der Träumer" ist hier Inspirationsgeber. Dem Träumen wohnt das große Gefahrenpotential der Desillusionierung inne. Der Barockdichter Paul Fleming fällt mir unvermittelt mit seinem Gedicht "Sey dennoch unverzagt" ein, das man der Ernüchterung entgegensetzen könnte; der dritte Song aus Maahns oben erwähntem Album heißt jedenfalls "Der Clown hat den Blues" … und damit ist eine weitere Assoziationskette in Gang gesetzt. Im narrativen Marionettenspiel Denis Diderots Roman "Jacques der Fatalist und sein Herr" meistert der an das Abspulen der großen Rolle gläubige Diener Jacques ein erstes Abenteuer, bei dem er mehrere rauflustige und unangenehme Gesellen couragiert in ihre Schranken weist. Der Schreck sitzt dem im sichereren Nebenzimmer gut aufbewahrten Herrn noch in den Gliedern, als er nach dem Was-wäre-wenn fragt: "Und wenn sie sich geweigert hätten …?" Darauf Jacques: "Das war unmöglich." - "Warum?" - "Weil sie es nicht getan haben." Meine nette Kollegin Frau Redhardt nennt es Gottvertrauen; meine Großmutter riet mir: "Manchmal muss man auch mal auf sein Glück vertrauen ...", sie ging mit drei Kleinkindern an der Hand Anfang 1945 aus ihrem sichergeglaubten Asyl im Spreewald ins zerbombte Berlin zurück. Im Hinblick auf die Träumer ergeben sich aus diesen Ausgangsüberlegungen zwei grundverschiedene Grundhaltungen: Es gibt die Haudegen und es gibt diejenigen, die eher zur Trübnis neigen - natürlich in allen nuancenreichen Übergängen, Überblendungen oder gar gleichberechtigt nebeneinander existierenden Komplementär-Temperamenten. Zu den Haudegen fällt mir Ernest Hemingway ein. Hinter seinem schroffen "he said"-Stil, aber auch seiner rauen Kämpfer- und Trinkernatur wird eine Feinfühligkeit der Beobachtung offenbar, die nicht so leicht in Einklang zu bringen scheint mit dem Bild des lauten Abenteurers. Die Schilderung des mutigen Erduldens des in seinem Missverständnis zum Sterben verurteilten Jungens in "A Day's Wait" oder die Poesie der Geschichte "Cat in the Rain" scheinen kaum mitfühlender ausgedrückt werden zu können. Berühmt wird Hemingways allegorische Schilderung des großen Fischs am Haken von "The Old Man and the Sea". Der sich erfüllende Traum des großen Fangs, der am Ende als zerflettertes Grätenskelett an Land gezogen wird, aber trotzdem Zeugnis von der Beharrlichkeit des Alten ablegt. Der Abenteurer und Abenteuerromane schreibende Jack London fällt mir ein, in späteren Lebensjahren pilgert er wohl auch zum Grab Robert Louis Stevensons auf Samoa. Es braucht einen Huckleberry Finn, der Tom Sawyer vom langweiligen Zaunstreichen abzieht und ihn auf Fluss-Abenteuer lockt. Mark Twain wird mit seinen Charakteren unsterblich. Die Underdogs modernerer Roadmovie-Romane werden brüchiger, vielleicht zerbrechlicher, trotz kraftvollen Nonkonformismus. Boris aus Donna Tartts "Der Distelfink" wird zum Abgrund, aber auch letztlich Auffänger Theo Deckers. Im Jugendroman, der mittlerweile zum Kanon der Schullektüre zählt, "Tschick" von Wolfgang Herrndorf sprengt der neue russische Mitschüler Tschichatschow alle Gewohnheitsmuster des Gymnasiums, bevor er mit dem wohlstandsverwahrlosten Maik in einen Lada steigt. Selbst der weltoffene Deutschlehrer ist mit der echten Brechtinterpretation Tschicks überfordert und alle scheinen erleichtert, als die gewissenhafte Klassenbeste die vermeintlich richtige Interpretation vorliest … "wie sie auch bei Google steht." Während meines Studiums in England fragte mich ein von mir sehr hoch geschätzter Dozent Dr. Martin Kane, was ich von der zu lesenden Romanlektüre Bölls "Ansichten eines Clowns" hielte. Es finden sich Hinweise, dass Böll selbst seinen Roman als zu konstruiert kritisierte. Dr. Kane drückte es aus mit den Worten "maybe a bit over the top". Es geht unter anderem um die Entzweiung eines Paares, der der großen Unversöhnlichkeit zweier Generationen zum Opfer fällt, um das deutsche Nachkriegsdrama der Auseinandersetzung mit der Mittäterschaft oder Mitläuferschaft der Eltern und um die Heuchelei und Starre der so genannten Adenauerära, die Schilderung des Verdrängens und Ausblendens jener Jahre. Es gibt eine Szene im Roman, die ich damals Dr. Kane in Erinnerung rief, die ihn zu den Worten veranlasste, ja das sei großartig, eine großartige Szene. Der junge Hans Schnier - sehr zum Missfallen des Vaters ein Clown - ist in der Not, etwas Geld zu brauchen. Der Vater bleibt blind für die äußere, aber eben auch innere Not seines Sohnes, der gekonnt vor seinen Augen mit einem D-Mark Stück jongliert. Die hüpfende Münze, die mit der Fußspitze gefangen und dem Vater unter die Nase gehalten wird, ist eines der Bilder, die in meinem Lesegedächtnis fest eingraviert überlebt.
... Gieb dennoch unverlohren.
Weich keinem Glücke nicht. Steh' höher als der Neid.
Vergnüge dich an dir / und acht es für kein Leid /
Hat sich gleich wider dich Glück' / Ort / und Zeit verschworen.
... heißt es weiter bei Paul Fleming. Eine solche Stärke mussten sich die neuen Träumer erst wieder erarbeiten. Sabine Bode ist diejenige, die die Mechanismen und das Ausmaß des Risses und der Unversöhnlichkeit erklären kann, doch das ist ein anderes Thema.
Eine kleine Auswahl v.l.n.r.: Denis Diderot mit Guy Fawkes Maske von Al Silonov: Denis Anonymous 2 (CC BY-SA 3.0 DE); Mark Twain, Ernest Hemingway mit kleinerem Fisch (Fotos mit großen Marlinen kennt man zur Genüge) - beide Fotos unbekannter Fotografen (auf Wikimedia Commons, public domain) und Heinrich Böll (Bundesarchiv, B 145 Bild-F062164-0004 / Hoffmann, Harald (CC BY-SA 3.0 DE).
Schnipsel 172: Kriegsenkel
Fotos: Links: Das zerstörte Dresden, Fotografen Renate und Roger Rössing, Deutsche Fotothek: Fotothek df roe-neg 0002584 001 Blick über Ruinen (CC BY-SA 3.0 DE); Mitte: Der Klett-Cotta Verlag erlaubt die Veröffentlichung von Buchcovern für Buchbesprechungen, vielen Dank; Rechts: Berliner Kinder klettern auf einer Häuserruine. Bundesarchiv, Bild 183-S88210 / Kümpfel (CC-BY-SA 3.0).
Unter folgendem Link kann man sich noch ein Filmdokument anschauen: Flug über Berlin 1945
Es ist ein anderer Kontext, in dem die Mahnung an das zweite von Moses übermittelte Gebot angehängt wird, in dem es um die fremden Götter geht: "Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen", doch die Botschaft spricht eine enorme tiefenpsychologisch untersuchbare Wahrheit aus, dass die Vergehen der Väter sich über mehrere Generationen in ihren - tatsächlich sehr unterschiedlichen - Symptomen zeigen, dass es also eine sehr subtile Vererbung der Kriegstraumata gibt.
Ich werde Sabine Bode nicht nur wegen dieses für das Thema tatsächlich ungeeigneten Formats nicht gerecht werden können, sondern auch deshalb, weil ich mich in ihrem Arbeitsfeld der Soziologie oder Psychologie zu wenig auskenne. Da sie eine Wegbereiterin für die Erforschung mehrerer Themenfelder ist, entladen sich um die Auseinandersetzung mit dieser Inblicknahme sogleich Kritikimpulse oder methodologische Zweifel, auf die ich ebenfalls nicht werde eingehen können. Was mich interessiert, ist die Pionierarbeit des genauen Hinsehens und das kluge Vernetzen von Auffälligkeiten unterschiedlicher Lebensläufe in ihren Hemmungen einer bzw. zweier Generationen.
Über das Buch stolpert man, wenn man Ende der 1960er oder Anfang der 1970er Jahre geboren wurde, weil das Coverbild einem so unglaublich vertraut vorkommt. Ein unbeschwerter Moment seltsam gekleideter Kindheit vor geöffneter Neubau-Terrassentür. Nach ihrer Erforschung der Nöte der Generation der Kriegskinder, die tatsächlich Hunger, Bomben, Verstümmelungen, Tod, Flucht usf. erlebt hat, wachsen deren Kinder in einer von den Schäden bereinigten Friedenszeit auf, behütet, TV unterhalten, ferngehalten von den Qualen, die die Lebenswirklichkeit des gleichen Landes, in dem sie leben, vor nur wenigen Jahren bestimmten. Die große Abrechnung mit der Vätergeneration, wie sie Hans Schnier - 27-jährig und somit ein Kriegskind - in Heinrich Bölls "Ansichten eines Clowns" vornimmt, mag schlüssig erklären, warum es einen enormen Bruch zwischen diesen beiden Generationen geben musste. Die erstaunliche Erkenntnis, die Sabine Bode mit ihrer Betrachtung der Lebensumstände der Kriegsenkeln gewinnt, ist, dass es einem mindestens ebenso großen Bruch zwischen den zähen Kriegskindern und deren in beruhigender Obhut geglaubten eigenen Kindern gibt. Methodisch weist Frau Bode klug darauf hin, dass es ihr nicht um eine Generalisierung gehe, ja selbst möglichen Kausalzusammenhängen nähert sie sich mit großer Vorsicht. Sie stellt Lebensläufe, Familienschicksale, Entwicklungsmuster nebeneinander, lässt betroffene Kriegsenkel ihre Geschichten erzählen und so treten die auffälligen Parallelen in ihren vielfältigen, aber vergleichbaren Facetten zutage. Mir klar, wie sehr die Kinder, die Ende der 1930er Jahre geboren wurden, geprägt wurden vom Krieg, obwohl die offensichtlichen Versehrtheiten wahrscheinlich eher an den Erwachsenen sichtbar oder spürbar waren. Natürlich verbinde ich das mit den Erzählungen meiner Großeltern, meiner Eltern. Das Spiel in den Trümmern Berlins. Bilder der brennenden Nachbarstadt Gießen, vom Heimatdorf meiner Mutter aus zu sehen. Wie gesagt, es ist nur ein kleiner Hinweis auf das lesenswerte Buch, das die Wahrnehmung seiner eigenen Familiengeschichte oder aber auch eigenen Wesensart um eine Erklärung bereichert. Es geht nicht um eine Relativierung der Not der Opfer des Nationalsozialismus, vielleicht geht es in erster Linie um die Mahnung, zu begreifen.
Schnipsel 173: Topsy-Turvy 2019
Das Foto von Chris Charousset ist auf der Webseite https://anv-cop21.org/100-portraits-macron-tour-eiffel/ unter der (CC BY-NC 3.0 FR) veröffentlicht.
In Rückgriff auf Schnipsel 88 und 128 frage ich mich, ob die französischen Klimaaktivisten meine Texte lesen oder selbst auf die Macht der umgekehrten Ikonografie gekommen sind ... Umkehr ... Abkehr ... décrochons Macron ... die neue Revolution hängt glücklicherweise vom Haken ("crochet") ab ... Paris am 8. Dezember 2019.
Schnipsel 174: Von Jekyll zu Gray zum Ginkgo

Das Poster ist gemeinfrei (auf Wikimedia Commons, public domain) zugänglich.
Die Erzählung "The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde" von Robert Louis Stevenson nimmt sich der Spaltung der Persönlichkeit des Menschen an. "... all human beings, as we meet them, are commingled out of good and evil." Die Neugier lässt den liebenswürdigen Dr. Henry ("Harry") Jekyll nicht eher ruhen, bis ihm experimentell die Abspaltung seiner dunklen Seite glückt. Einmal entfesselt, kann Edward Hyde aber von ihm nicht mehr in Zaum gehalten werden. "I still hated and feared the thought of the brute that slept within me." Stevenson kreiert mit seinen Charakteren Prototypen eines inneren Spaltungsexzesses. Seit seinem literarischen Erwachen wird z.B. Mr. Hyde gerne bemüht, wann immer es gilt, einen Namensgeber für einen isolierten Finsterling zu benötigen, der sich aus der Fülle der möglichen moralischen Mischungsverhältnisse zugunsten einer menschlich abgründigen Veranlagung recht einseitig herauskristallisiert hat. Dr. Jekyll besitzt noch die Kraft und Güte, im Stadium einer letzten Kontrolle über seinen innewohnenden Bösewicht diesen der Justiz ans Messer zu liefern. Der irische Schriftsteller Oscar Wilde hat mit dem Bildnis des Dorian Gray ein ähnlich erfolgreiches Motiv ersonnen, in dem eine Abspaltung gelingt, die sich den Menschheitstraum ewiger Ansehnlichkeit und Jugend zu erfüllen sucht. Dorian Gray gelingt es, dass sein Alterungsprozess nur Spuren auf dem Öl-Porträt hinterlässt, das lange hinter dicken Vorhängen verborgen bleibt. Das Motiv der Polarität oder der rumorenden, ringenden Lebensentwürfe, die unter den Einflüssen diametral angeordneten innerer Richtungsgeber stehen, findet sich, woimmer Künstler den Bannkreis des Menschlichen ausloten wollen ... oft in Auseinandersetzung mit den eigenen Polarregionen. Thomas Manns Thema Künstler vs. Bürger - die selbstzerstörerische Disziplin des Kaufmanns Thomas Buddenbrook in wütend komplementärem Arrangement zu seinem halbseidenen Bruder Christian. Selbst Thomas Mann im eigenen Streit mit seinem Bruder Heinrich hinsichtlich der rechtzeitigen politischen Verortung. Das Motiv der Spaltung steht immer mit dem Symptom der Unversöhnlichkeit in Verbindung. Die größte Gefahr dieser einmal ins Leben gerufenen Unversöhnlichkeit ist eine lange Abwendung zweier sich doch recht nah stehender Personen(anteile); dieser gegenseitigen Abkehr voneinander wohnt eine große zerstörerische Kraft inne. Klüger unter heutiger Streitschlichtungskenntnis ist, im vermeintlichen Widersacher den kleinen Restanteil des Gegenentwurfs zu entdecken. Ich weiß nicht, ob man Komplementärkontraste versöhnen kann, aber im mächtigen japanischen yin-yang Symbol ist die Versöhnbarkeit der in Bewegung befindlichen Schwarzweißgrenzen angelegt. Komplementär könnte gegebenenfalls mit der Idee des Komplettierens in Verbindung gebracht werden. Im nächsten Text geht es um eine große Abspaltung mit einer vielleicht noch folgenreicheren inneren Spaltung. Die versöhnlichsten Worte zur inneren Seelenbefindlichkeit hat wohl Johann Wolfgang Goethe gefunden und die alte "Zwei-Seelen-wohnen-ach-in-meiner-Brust"-Stelle von Heinrich Faust in ihre Schranken gewiesen:
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut,
Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?
Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?
Fotos v.l.n.r.: Frühe fotografische Umsetzungen von Arthur French und Henry van der Weyde mit Schauspielern des Dr Jekyll & Mr Hyde; das yin-yang Symbol; ein nicht so häufig gezeigtes Foto von Oscar Wilde und daneben ein Gemälde "Dorian Gray" von Jacques-Émile Blanche, das eine eigene Geschichte erzählt (alle Abbildungen auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel 175: John le Carrés Federball
Fotos v.l.n.r.: Ein "shuttlecock" von BlackKnight (auf Wikimedia Commons, public domain), die deutsche Botschaft London veröffentlicht 2017 ein Foto von John le Carré während einer Rede German (Embassy London, John le Carré giving his thrilling keynote speech (35280372555) (CC BY 2.0); ein Abflug fotografiert von BriYYZ from Toronto, Canada, British Airways, Boeing 767-300, G-BNWS (16895368731) (CC BY-SA 2.0).
Beide Titel, ob auf Englisch oder Deutsch, haben ein überzeugendes Konnotationspotential. Der (Titel) "Federball", der über das Netz geschlagen wird, gefällt mir am Ende mindestens so gut wie der englische Originaltitel "Agent Running in the Field". Im Herbst 2019 kann man viele Bücher in die Hand nehmen, und es finden sich viele Themen verarbeitet, die der Leser oder die Leserin um ihr eigenes Problembedürfnis gruppieren kann. Die Bücher gelangten - wie so häufig - von sich aus in meine Hände. Salman Rushdie "Quichotte", Ian McEwan "The Cockroach", dann John le Carré "Federball". Die Erkenntnis dieses Leseherbstes, die englischsprachigen Autoren schienen sich unabhängig voneinander im Klaren darüber gewesen zu sein, dass es eine Aufgabe sein könnte, auf ihre politische bzw. gesellschaftliche Gegenwart zu reagieren. Da passiert etwas in der Welt, und es fordert zur Positionierung heraus. Der Spionageroman von John le Carré hätte wohl von wenigen Menschen nach 1989 eine Überlebensfähigkeitsprognose bekommen. Heute, mit 88 Jahren, postuliert le Carré, dass selbst der nächste Roman bereits noch in ihm warte und er eigentlich keine Zeit habe zu sterben. Der diplomatische Nach-Kalte-Kriegs-Zirkus, die Tragweite des Tschetschenien-Krieges, die Veränderungen nach dem 9/11-Trauma ... seit vielen Jahren passt sich in den Romanen le Carrés die Heimlichkeit des Untergrunds ihren äußerlichen Bedingungen an, ohne ihre bieder-gefährliche Wesentlichkeit zu verlieren, wär hätte da glauben können, dass ein paar geöffnete Schlagbäume die Quelle, aus der der Meister der espionage-Literatur schöpft, zum Versiegen bringen. John le Carré muss man tatsächlich in seiner Verwobenheit, langsamen und oft verschleiernden Entfaltung des Plots und dem meisterlichen Verwirrspiel der Personenkonstellationen mögen. Seine Helden sind sich zum Teil in ihrer Veranlagung oder oft angreifbaren Rolle innerhalb des bürokratischen Spionage-Hierarchie, die sie heran- und großgezogen hat, ähnlich. Es dauert etwas länger, bis einen die Seiten in ihren Spannungszauber schlagen und man abtaucht in die düstere Welt des organisierten Verrats mit doppeltem oder dreifachen Boden. Auch die Schauplätze sind vertraut, nur die Hausherren der Villen in der Schweiz, der Karibik oder hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang haben den Geschäftszweig oder ihre Ideologie gewechselt.
In "Federball" positioniert sich John le Carré als Mahner, dass die Hausherren der obersten Kaste seines Landes und deren neuerlichen Gäste tatsächlich nichts Gutes im Schilde führen. In einem Interview lächelt er britisch-verschmitzt, als ihm der Journalist mit der Formulierung konfrontiert, er habe den Brexit im Roman in seiner Absurdität bewertet ... nein, er habe viel krassere Worte dafür gefunden. Und tatsächlich geben im Roman wesentliche Charaktere eine Stellungnahme zu Großbritannien, dem Besucher aus den USA, aber auch dem gefährlichen Machthaber in Moskau ab, die ohne Umschweife sind: "Großbritannien rollt den Teppich aus für einen gewissen amerikanischen Präsidenten, der gekommen ist, um die schwer erkämpften Beziehungen zu Europa zu verhöhnen und die Premierministerin zu erniedrigen, die ihn eingeladen hat" ist dabei noch ein moderates Zitat. Damit in einem Londoner Pub Harmonie herrschen kann, hat der Landlord das Schild hinter die Bar gehängt: "Der Brexit muss draußen bleiben." Ich erinnere mich an das Zitat meiner Studienzeit, das mir als Deutschen immer entgegenlächelte: "Don't mention the war ..."
"Er ist ein Träumer, nicht wahr?", charakterisiert die graue Eminenz der Londoner Russlandabteilung den politischen Idealisten Ed, der unter die Räder zu geraten scheint. Hier sollte ich nicht zu viel verraten, auch wie meisterlich intrigant es einigen Old-School-Haudegen gelingt, am Ende einen ungewöhnlichen Exodus zu organisieren, man wundert sich tatsächlich diesmal, wie die Fluchtrichtung ist und welchen Coup die Geheimdienste ihrer Majestät im Schilde führen. John le Carré scheint auf der Seite derer zu stehen, der warnt, dass man politischen einen großen Fehler begeht, wenn man den falschen Gangsterbossen vertraut und gewachsene Vertrauensbündnisse leichtfertig aufs Spiel setzt. Sein Land ist über diese Fragen in unserer Zeit tatsächlich sehr tief gespalten ... ob die Profiteure des Spiels mit dem Feuer tatsächlich wissen, was sie tun ...? McEwan, Rushdie, le Carré lassen uns zweifeln.
Fotos: Oben: Das Europaparlament in Strasbourg von Diliff (Autor): European Parliament Strasbourg Hemicycle - Diliff (CC BY-SA 3.0).
Mitte: Ein mächtiger, nicht bei allen willkommener Gast im Juni 2019 mit der Premierministerin (auf Wikimedia Commons, public domain), Alisdare Hickson fotografiert 2017 einen Demonstranten gegen Mr. Trump mit literarischem Bezug: Alisdare Hickson from Canterbury, United Kingdom, I prefer Lord Voldemort (to Trump) - Demonstrator at London anti-Trump rally. (32263020650) (CC BY-SA 2.0); das Weiße Haus veröffentlicht ein Foto mit der Queen 2018 (auf Wikimedia Commons, public domain).
Unten: Die Bilder ähneln sich, das yin-yang der tiefen Spaltung Großbritanniens - Nachahmer formieren sich im Rest Europas. Links die Anti-Brexit Demonstranten fotografiert von Ilovetheeu 2019: Anti-Brexit, People’s Vote march, London, October 19, 2019 15 (CC BY-SA 4.0); rechts die Ausstiegsbefürworter von ChiralJon: Brexit Demonstrators (CC BY 2.0).
Schnipsel 176: Die Ebene verlassen - Chitty Chitty Bang Bang
Fotos: Links ein Chitty Chitty Bang Bang Nachbau aus England von Robert Linsdell: Robert Linsdell from St. Andrews, Canada, Beaulieu National Motor Museum, Hampshire (460930) (9457688212) (CC BY 2.0); rechts ein Chickadee Vögelchen von SRWvong: Chickadee in the blossoms (CC BY-SA 4.0).
Wenn es unten zu anstrengend wird, ist es manchmal sinnvoller, ein fliegendes Gefährt zu besitzen, mit dem der Alltag hinter sich gelassen werden kann. Pippi Langstrumpf besaß ein solches mit Kleber angetriebenes Auto aber auch eine waghalsige Bett-Ballon Konstruktion. In der deutschen Kinderbuchliteratur gibt es ein Fliewaatüt und Pan Taus roter Schiffs-Kopter ist wohl die traumwohligste Konstruktion der tschechischen Kinderfilmindustrie des zwanzigsten Jahrhunderts. Musikalisch eher traditionell verlässt John Denver den Boden mit "Leavin' on a Jetplane", zu dem einmal ein Moderator einer lokalen Rundfunkstation den Hinweis gab, es handle sich nicht um einen Himmelfahrtssong. Nur das Gefährt aus dem Musicalfilm Chitty Chitty Bang Bang verleiht uns an dieser Stelle Flügel, die Sprachebene der Onomatopöie im Flug inklusive Auspuffgeknatter zu erobern. Also, hier sind meine Chartplatzierungen der Top-Ten literarischen Lautmalereien:
Platz 10: Dieter Hallervorderns Palim Palim der einmal offen gelassenen Tür im Laden, in dem nach einer Flasche Pommes Frites gefragt wird.
Platz 9: Die Poeten, die dem Kikeriki im Englischen den Klang Cock-a-doodle-do und dem französischen stolzen Hahn den Ausruf Cocoriko beschert haben.
Platz 8: Ian McEwans Idee, den euphorischen Cockroach Prime Minister den 60er Jahre Schlager "Walking back to Happiness" als Hymne für den Reverse-Day vorschlagen und ihn dabei Finger kreisend den Refrain woopah oh yeah yeah schmettern zu lassen.
Platz 7: Disneys Heigh-ho-heigh-ho-Parade der singenden Zwerge, die nach der Arbeit wieder froh sind ...
Platz 6: Robert Louis Stevensons Piratenlied mit dem Riff yo-ho-ho and a bottle of rum.
Platz 5: Das oben erwähnte Geknatterlied, das dem wunderbaren fliegenden Auto seinen Namen gab: Chitty Chitty Bang Bang.
Platz 4 und 3: Leopolds gigantischer Furz im Sirenen-Kapitel: Pprrpffrrppff (... es gibt auch ein tattarrattat eines Türklopfens in "Ulysses", das als längstes englisches Palindrom gilt.)
Platz 2: Kurt Vonneguts zirpender Singvogel mit seinem "Chick-a-dee-dee-dee" went a chickadee in der "schönsten aller kitschigsten Liebesgeschichten" (ich glaube ein Zitat Vonneguts) "A Long Walk to Forever".
Platz 1: Die Ansagen in Prager Bussen, die mir mitten in einer Kafka-Hausarbeit steckend in jeder nächsten Haltestelle das Wort *dchichdina-kafka auditiv unterjubelten.
Und mit Kafkas kleiner Erzählung gelingt gleichzeitig das schönste "Sich-von-der-Welt-lösen", das ich kenne (der Hinweis erfolgte natürlich in einem Glück-Seminar):
Wunsch, Indianer zu werden
Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit, und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.
Bleibt ein kleines Detail nachzutragen, das Kinderbuch "Chitty Chitty Bang Bang" wurde tatsächlich vom 007 Erfinder Ian Fleming geschrieben, von dem man leider gemeinfrei kein einziges Foto findet. Was hätte ich auch um ein Foto des Fluggeräts von Pan Tau gegeben, aber selbst das Bild eines Nachbaus besitzt keine Copyright Freigabe. Die folgenden Bilder erheben somit auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern Träumerei.

Fotos: Oben v.l.n.r: Otto Šimánek (c) Otto Hofmann Archiv, Bildrechte Caligari Film- und Fernsehproduktion, Freigabe für redaktionelle Zwecke. Caligari-Produktion startet 2020 eine Neuauflage von Pan Tau. Ein Flugauto von Kobel Feature Fotos als Platzhalter für Pan Taus Flug-Schiff, dann Astrid Lindgren (beide auf Wikimedia Commons, public domain).
Mitte: Lillian Boyer 1922 auf einem Doppeldecker-Flügel (auch hier gibt es filmisch ein schönes Bild von Pan Tau); Kurt Vonnegut als Soldat ähnlich dem werbenden Fahnenflüchtling aus "A Long Walk to Forever"; schließlich Robert Louis Stevenson beim König von Hawaii (alle auf Wikimedia Commons, public domain).
Unten: Kafka mit einem Anflug eines Lächelns (auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel 177: Ein Ende von Sprache - Chandos
Fotos: Zweimal Hugo von Hofmannsthal und innerhalb von Rot Francis Bacon (auf Wikimedia Commons, public domain).
Mehr als 3000 Wörter braucht Hugo von Hofmannsthal Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, um in einem fiktiven Brief, den ein Lord Philip Chandos an den Gelehrten Francis Bacon adressiert, ein zukünftiges Schweigen zu begründen und haarklein die Diagnose der nervösen Verfassung darzulegen, als dessen Symptom sich die Unfähigkeit des Fassens der Welt in Sprache zeigt. Die gleichen Fragen, die ich schon mit 17 im Deutschunterricht bei Frau Bremer hatte, beschäftigen mich auch heute über dreißig Jahre später noch. Warum diese seltsame Verschachtelung dieses fiktiven Settings, warum der Rückgriff auf das 17. Jahrhundert, warum Bacon? Immer wieder die gleichen Reflexe. Recherche Bacon. Verlassen dieses Pfades hinsichtlich dieser allzu komplizierten Vita in all ihren Ebenen. Hinwenden auf die Aussagen, die mich auch heute noch fesseln und die ich vor dem Hintergrund der großen Zeitenwende um 1900 begreifen kann. Da schildert ein junger Schriftsteller, dass ihm die einstmals gefühlte Einheit der Dinge verloren gegangen sei, eine einstmals so sättigende Geistesnahrung in Form von Folianten - vergleichbar im Wesen mit frisch gemolkener Milch - sich ihm zunehmend im Zweifel an die Aussagekraft des Wortes entzog ... dass ihm schließlich Worte im Munde wie modrige Pilze zerfielen. Dann das unvergessene Bild in wenigen Zeilen einer sich verflüchtigenden, wegbrechenden, fallend-unaufgefangenen Religiosität: "... dergleichen religiöse Auffassungen haben keine Kraft über mich; sie gehören zu den Spinnennetzen, durch welche meine Gedanken durchschießen, hinaus ins Leere." Die Bestandsaufnahme in einem Satz: "Mein Fall ist, in Kürze, dieser: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen."
Bereits in Schnipsel 89 habe ich auf die lange Tradition des Unsagbarkeits-Topos hingewiesen. Als Schüler leuchtete mir ein, warum unsere Deutschlehrerin mit dem Chandos-Brief ihre Einheit zur literarischen Moderne einleitete. Ich mache es heute ähnlich. Dann zeige ich ein Bild Picassos aus seiner Akademiezeit - buste de jeune homme - auf der man die Kunstfertigkeit in der Abbildung eines Menschen erkennen kann. Das nächste Bild ist ein späterer Picasso, der verlangt, eine große Hürde zu überwinden, um die Befremdlichkeit zunächst einmal nur zuzulassen, die ein solches Bild auslöst. Eine Zeitenwende wie die ins 20. Jahrhundert erfordert einen neuen Blick auf den Menschen, alte Ausdrucksformen verlieren ihre Fähigkeit, sich der neuen Lebenswirklichkeit anzunehmen, sich ihr neu zu nähern, ihr dann eine echtere Beschreibung geben zu können, für die die alte Ausdrucksweise nicht ausreichte.
Es ist sicherlich viel komplizierter und genauer erforscht und beschrieben, als ich es hier in dünnen Worten zu fassen vermag. Trotzdem erfreue ich mich jedes Mal, wenn ich dem Chandos-Brief von Hofmannsthal eine neue Nuance abzuringen versuche, um am Ende doch wieder an denselben vier Stellen hängenzubleiben, die ich bereits mit 17 begriffen hatte. Mit den Jahren konnte ich tatsächlich einige weitere Ideen um den Chandos-Brief gruppieren: Eichendorffs Taugenichts, dem die Zahlenlogik abhanden kommt im Versuch, mit den Ziffern bodenständig als Verwalter zu haushalten. Der Begriff der Entfremdung von Arbeitsprozessen fällt mir ein - nicht nur in der Theorie von Karl Marx, sondern auch in der konkreten Schilderung der eingeführten Fließbandproduktion in der Stuttgarter Lederwarenindustrie, wie sie mein Vater erlebt hat. Seine Konsequenz war die Aufgabe eines Arbeitsplatzes, der nicht mehr einen ganzen Koffer zu produzieren hatte. Es fällt mir Heinrich Bölls "Dr. Murkes gesammeltes Schweigen" ein und Hilde Domins Anliegen, der Gefahr, dass in den falschen Mündern das Wort Freiheit zur Floskel verkommenen könnte, zu begegnen, indem sie es mit Scherben spickt, damit die Worthülsensammler es verschonen oder es nicht durch diese unter die Räder der Abgedroschenheit gerät. Mir fällt Brechts Vers "Die Sprache verriet mich dem Schlächter" ein. Mir fällt leider auch der Pädagogik-Sprech meiner Ausbildungszeit und Gegenwart ein. Mir fällt die Mahnung durch George Orwell ein, dass Dinge zu doppelplusgut in der Sprache der Autokraten und ihrer feisten Bürokratie verarmen könnten. Mir fällt seit gestern die kluge Formulierung "Vertrauensverlust in den Bedeutungs- und Wirkungsgehalt des Kommunikationsmittels ‚Wort‘", die Rüdiger Görner leider besser, als ich es je könnte, zu Chandos gefunden hat, ein. Leider fällt mir ebenfalls seit gestern der Streit zwischen Alfred Kerr und Karl Kraus - den man in der "Allwissenden" suchen darf - ein. Ich weiß nicht, wer der rechtschaffenere war, aber hier lass ich Karl Kraus - leicht abgewandelt - das letzte Wort: "Wer [jetzt noch] etwas zu sagen hat, trete vor und schweige." Und ja, die Sätze sind sperrig.
Fotos: Links ganz links Alfred Kerr in einem Berliner Salon, rechts Karl Kraus, Herausgeber der "Fackel" hier fotografiert von Hermann Schieberth (beide Bilder auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel 178: Pensieve
Cleggan Bay, Ireland (c) Stefan Scheffler.
Silbrig mysteriös glänzt die Oberfläche im flachen Steinbecken in Professor Dumbledores Zimmer. Der Glanz aus der nicht ganz geschlossenen Tür des Wandschrankes (cabinet) zieht Harry Potter magisch an und er verliert sich im Sog des Erinnerungsbasins des großen Zauberers Albus Dumbledore, der Harry nach seinem Fall in die Tiefen der ausgelagerten Gedanken des Meisters zurückholt. "This? It is called a Pensieve," said Dumbledore. "I sometimes find, and I am sure you know the feeling, that I simply have too many thoughts and memories crammed into my mind."
Als ich im Herbst vor zwei Jahren nicht wusste, was ich mit meiner aus Eitelkeit erstandenen Domaine ".com" anfangen sollte, hätte ich mir tatsächlich nicht träumen lassen, auf welchen Umfang mein Geschnipsel innerhalb von drei dunklen Jahreszeiten anwachsen würde bzw. auf welchen Umfang sich im Dachboden meines Lesegedächtnisses über die Jahre ein Wust an Details angesammelt hatte, der bisher an keiner Stelle mehr zu gebrauchen war, einem Teil in mir aber auch zu wertvoll erschienen war, um ihn nicht dort in Ruhe vor sich hinschlummern zu lassen, bis eben eine erste Notiz auf einem Zettelchen eine Kettenreaktion auslöste und nach ein paar Minuten eines Sonntagmorgens sich kaum mehr eine abgerissene leere Zeitungsecke, eine halbleere Buchseite, auf der ein Kapitel zu Ende gegangen war und Platz für eine halbe Seite Unbeschriebenes gelassen hatte, oder sonst ein Zettelchen fand, um die immer neuen Ideen und Erinnerungen in aller Kürze zu notieren, um sie nachts auf dieser Homepage unter dem Titel "Nebenpfade der Literatur" abzutippen. Es fühlte sich so ähnlich an wie Dumbledores Auslagern seiner Gedanken, die er mit Hilfe seines Zauberstabes aus der Gegend seiner Schläfen in sein Pensieve zieht. In gewisser Weise ein Stöbern, wie es Umberto Ecos Held Giambattista mit seinen Comicfunden auf dem Dachboden in "Die geheimnisvolle Flamme der Königin Laona" unternimmt, um seine Kindheit und sein Leben zu rekonstruieren.
Manchmal ergab sich über die Freiheit, Assoziationen zuzulassen, ein buntes Sammelsurium skurriler Nebeneinander, manchmal war ich am Ende eines Zehnerblocks erstaunt, wie stark sich eine Leitidee oder mehrere kleinere, versprengte, aber hartnäckig um Aufmerksamkeit ringende Motive sich immer wieder durchsetzten, sich Gehör verschafften, durchschienen, sich an die Oberfläche kämpften oder nur leise hinter den Sätzen zwinkerten, und schließlich die einzelnen Schnipsel zusammenhielten oder miteinander verwoben. Und auch mein Nachdenken über das mir sehr sympathische Pensieve vom großen Zauberer von Hogwarts brachte erst einen, dann einen zweiten Dominostein meines Denkens in Konsequenzen auslösende Schieflagen ...
Kurt Pinthus war Herausgeber der progressivsten Lyrikanthologie Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, die den Namen "Menschheitsdämmerung" trug. In den Schulbüchern hat 1925 die Bestandsaufnahme seiner Gegenwart mit dem Titel "Die Überfülle des Erlebens" überlebt, in der er die Reizüberflutung der neuen Zeit in Worte fasst, beginnend mit dem Satz: "Welch ein Trommelfeuer von bisher ungeahnten Ungeheuerlichkeiten prasselt seit einem Jahrzehnt auf unsere Nerven nieder!" Nicht mehr lange, und der Text wird 100 Jahre alt sein. Die Schlussfrage von Pinthus scheint in unserer überreizten Welt noch dringlicher: "Vermögen wir uns noch zu wundern?" Auch hier scheint jemand an die Grenzen eines Angefülltseins, einer Überlastung zu kommen. Ein Trommelfeuer und Sättigungsgefühl ganz anderer Art lösten die ersten Sätze von Thomas Manns Roman "Joseph und seine Brüder" aus:
Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen? Dies nämlich dann sogar und vielleicht eben dann, wenn nur und allein das Menschenwesen es ist, dessen Vergangenheit in Rede und Frage steht: dies Rätselwesen, das unser eigenes natürlich-lusthaftes und übernatürlich-elendes Dasein in sich schließt und dessen Geheimnis sehr begreiflicherweise das A und das O all unseres Redens und Fragens bildet, allem Reden Bedrängtheit und Feuer, allem Fragen seine Inständigkeit verleiht.
Ca. zweihundert Seiten habe ich geschafft, mehr nicht. Aber die Bedeutung der Stadt Ur, die Idee einer Ur-Stadt und die Verbindung zum Wort Origin und die Verbindung zu Dan Browns Roman und die Innenwände dieses von Thomas Mann im Fall erlebten Brunnens werde ich nie vergessen, und wenn doch, steht es jetzt hier, in meinem Pensieve.
Das Auslagern des Gedächtnisses, das im modernen Wiki & goo Zeitalter möglich erscheint, wird gebührend untersucht. In diese Richtung werde ich keine Fährte aufnehmen. Ein anderer, gänzlich gegenläufiger Gedanke hat mich einmal interessiert und wird ebenfalls hier abgelegt. Ray Bradbury lässt in seiner Dystopie "Fahrenheit 451" den Feuermann Guy Montag in die Waldwelt der Auswendiglerner eintreten. Diese wandelnden Menschen, die die Texte der Literatur in ihren Köpfen memorisieren, damit sie eine Überlebenschance haben in einer Welt, in der sie von der Gefahr bedroht werden, den Flammen der Herrscher zum Opfer zu fallen, die im Werk der komplexen Idee das Übel schlechthin sehen und im Dauer-Doping mittels permanenter schaler Bildschirmberieselung einen Schlüssel zur Beherrschbarkeit der konsumbereiten Massen erkannt haben. Trotz der Stärke und Emotion des Bildes, ich hatte immer meine Zweifel, ob ein solches inneres Anfüllen von Wenigen tatsächlich möglich sei; im zweiten Kapitel ist der Zweifel in der Kapitelüberschrift "The Sieve and the Sand" angelegt. Das müsste ich aber noch einmal nachlesen, tatsächlich habe ich nur einen sehr begrenzten Speicher für die wichtigen Details.
Vor dem Ende dieser Schnipsel noch der unwichtige Hinweis, dass ich stolzer Besitzer eines Fotos eines Klingelschildes mit dem Namen Truffaut bin aus einem Flur eines Hauses am Montmartre, unter dessem Dach ich eine klitzekleine Weile gewohnt habe, und - damit in keinen Zusammenhang zu bringen - dass Kurt Pinthus tatsächlich auch unter dem Pseudonym Potter geschrieben hat, Paulus Potter, und da gibt es wieder einen niederländischen Maler mit Pferden.
Fotos v.l.n.r.: Oben: Truffaut als Klingel (c), Ray Bradbury, ein Pferd von Paulus Potter und Kurt Pinthus (Fotos zwei bis vier auf Wikimedia Commons, public domain). Untere Reihe: Thomas Mann (auf Wikimedia Commons, public domain), ein Buchladen in Rom von Sheila1988: Libreria Fahrenheit 451 (neuer Zuschnitt), (CC BY-SA 4.0); Francois Truffaut sowie J.K. Rowling (beide auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel 179: Zunge am Backenzahn
(c) Stefan Scheffler
Schlussstrich. Im 74. kleinen Text habe ich Thomas Manns Hanno Buddenbrook bemüht, den Schlussstrich zu ziehen. Jetzt berufe ich mich noch einmal auf ihn, da er sich durch eine Geste, mit der ihn Thomas Mann zum literarischen Leben erweckt hat, fast täglich für einen Moment in Erinnerung ruft. Es ist so ein kleines Motiv, ein Federstrich, für den diese Schnipselvitrine geschaffen wurde bzw. von der sie lebt. Zähne sind im Hause Buddenbrook ein ebenso heikles Thema wie die blauen Schläfenäderchen bei anderen fragilen Charakteren von Thomas Mann, denen oft nur ein kurzes Schicksal auf den Seiten seiner Prosa vergönnt ist. "Hanno saß ganz still, die kleinen Hände um sein Knie gefaltet und, wie er zu tun pflegte, die Zunge an einem Backenzahn scheuernd, wodurch sein Mund ein wenig verzogen wurde." Jedes Mal, wenn ich selbst meist selbstvergessen diese Geste wiederhole, denke ich an diese Zeilen. Jedes Mal, wenn mir das Wort "leiden an" in der Übersetzung "to suffer from" über den Weg läuft, denke ich an einen sehr liebenswürdigen englischen Dozenten in Canterbury, Paul Coggle, der in einem Übersetzungsseminar mit Hingabe über die besondere Herausforderung sinnierte, die beim Übersetzen der Manns auftauche. Hier war es Diederich Heßlings erster Auftritt in Heinrich Manns Roman "Der Untertan": "Diederich Heßling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt."
Es sind diese kleinen Ideen, Federstriche, die, auch wenn das meiste von dreihundert oder vierhundert Seiten verblasst ist, eine sehr lange Halbwertszeit in mir haben. Einige sind sehr bekannt wie der blutige Dolch, der sich Shakespeares Macbeth halluzinatorisch vors innere Auge drängt - "Is this a dagger I see in front of me?" -, andere Gesten wurden wohl tatsächlich erst durch mein Lesen dem eigentlichen Geschehen hinzugefügt wie z.B. meine fixe Idee, dass Hamlet Polonius den Arm um die Schultern gelegt hat, als er ihm die Wolken zeigt und als dessen schmieriges Nach-dem-Mund- oder vielmehr -Sinn-Reden ihn für den sensiblen dänischen Prinzen als Verräter und wachsweichen Opportunisten entlarvt: "Do you see yonder cloud?" Die Geste bleibt, den Zusammenhang muss ich immer wieder nacharbeiten. Auch die Details, wer sich in Charles Dickens "A Christmas Carol" Ebenezer Scrooge im Türklopfer gezeigt hat, hatte ich vergessen - es war sein verstorbener Partner Jacob Marley, wie ich seit gestern von einer belesenen Kollegin erfuhr - aber in Erinnerung hatte ich das Verzögerungsmoment, den Zweifel im Blick, dass der beginnende Spuk tatsächlich kein humbug ist, sondern der große Zauber über Mr. Scrooge tatsächlich hereinbricht, um diesen vom Irrglauben des Geizes und der Jagd nach dem ewigen Mehr abzubringen. Es ist das Gesicht, das vielleicht nie von Jane Austen tatsächlich mit Worten gezeichnet wurde, das ich aber sehe, wenn sich mit Bennet in seine wertvolle Bibliothek flüchtet, um vor den schalen Ränken der Verheiratung seiner Töchter Reißaus zu nehmen … und sein mögliches Gesicht, wenn er dabei gestört wird, um über die neuesten Nebensächlichkeiten in Kenntnis gesetzt zu werden. Es ist das duldende, um Jahre reifere Gesicht von Schatz in Ernest Hemingways Kurzgeschichte "A Day's Wait", das seinen frühen Tod begreift und sicherlich einen ganz besonderen Ausdruck trägt, den, der unter tiefen Schichten trotz aller Versteinerung verraten könnte, dass er zwar wirklich seinen Vater von den lästigen Beeinträchtigungen seines auf dem großen Missverständnis dieser Geschichte aufbauenden, Gott sei Dank nur fälschlich angenommenen Sterbens bewahren will, dass er aber auch unter der Enttäuschung leidet, wie teilnahmslos dieser bleibt. Wie wenige Zeichen braucht Hemingway: "... staring still, as he had stared, at the foot of the bed" und auch das neue Gesicht, das neue Lebensglück zurück im Ausdruck eines normalen Neunjährigen bedarf nur weniger Worte, um es im Lesen zu sehen: " ... he cried very easily at little things that were of no importance."
Die Quelle dieser Details als Fundus für meine Lesebegeisterung scheint groß zu sein, die Quelle scheint tatsächlich die Nebenarme meiner Gedankenströme beim Lesen zu speisen, aber an dieser Stelle mit der schönen Primzahl 179 ist ein würdiger Endpunkt für mindestens eine überschaubare Ewigkeit erreicht. Es gibt noch so viele Fingerzeige, die mir unter den Nägeln brennen, die ich gerne hier auslagern würde: Holden Caulfields graue Strähne oder die roten Strähnen von Louis Veyrenc. Das Begreifen über die Finger eines Trinkers, die entlang der Häuserfronten laufen, in einer Geschichte F. Scott Fitzgeralds bekam hier bereits irgendwo seinen kleinen Platz. Die mahnende Langsamkeit der noch auf eine lange Zeit nicht zum Stillstand kommenden Drehbewegung des hängenden Körpers des Savage - "Slowly, very slowly, like two unhurried compass needles, the feet turned towards the right; north, north-east, east ..." - aus Huxleys "Brave New World" gehört hier hin ebenso wie Stefan Zweigs Schilderung des Sogs ins Schachspiel, das am Ende keine Figuren mehr braucht, oder der mit einem Kreuz-Orden zu stolzer Berechtigung scheinbar geadelte Adamsapfel eines Herrn Mahlkes aus Günter Grass Erzählung "Katz und Maus" und so vieles mehr könnte hier her gehören. Gil Ribeiros Leander Lost darf ich nicht vergessen, die Starre seines besonderen Blickes aber auch die Erklärung, warum man in Portugal bis heute kaum Klingelschilder finden wird. Aber die Primzahl setzt die Zäsur: 179. Ende Worte.

Fotos: Obere Reihe: Jane Austen von James Andrews nach einer Skizze von Cassandra Austen, Charles Dickens gemalt von Francis Alexander 1842 in Boston, F. Scott Fitzgerald fotografiert von Carl van Vechten sowie Günter Grass von SpreeTom (alle auf Wikimedia Commons, public domain).
Mittlere obere Reihe: Die große Hemingway Familie (Ernest als Junge in der hinteren Reihe), Aldous Huxley, Ausschnitt aus einem Gemälde von John Collier, die Brüder Thomas und Heinrich Mann sehr klein, ein Ausschnitt aus dem sogenannten Cobbe Portrait eines unbekannte Malers, das eventuell Shakespeare zeigen könnte (alle auf Wikimedia Commons, public domain).
Mittlere untere Reihe: Gil Ribeiro Buchcover aus dem Verlagsprogramm von KiWi, eine alte Ausgabe von P. D. Salingers "Catcher in the Rye" (auf Wikimedia Commons, public domain); ein Buchcover aus der Fred Vargas Reihe um Kommissar Adamsberg des Aufbauverlages und schließlich ein Foto der Linken Fraktion im Bundestag im Gedenken an die Bücherverbrennung mit einem Exemplar von Stefan Zweig: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, 120510 LgdV Buch nah-200dpi (7170998648), (CC BY 2.0).
Bild unten: Die Trinity College Library in Dublin, von Diliff: Long Room Interior, Trinity College Dublin, Ireland - Diliff (CC BY-SA 4.0).
179II: Simsalabaseladusaladim

Ein letzter Träumer, der an der Uhr hängt: Harold Lloyd ...
Ein Papier-Foto eines unbekannten Fotografen (auf Wikimedia Commons, public domain).