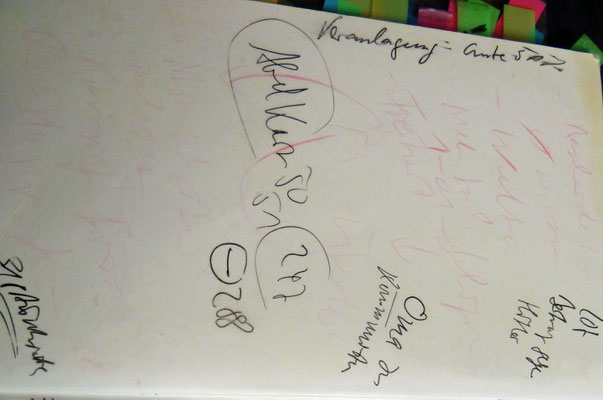Schnipsel einundneunzig: Karl Poppers Bescheidenheit
In einigen späteren Aussagen des älteren Karl Popper regt sich mein Widerstand und ich frage mich, warum man beim Lesen eines Philosophen nie die ganze Zufriedenheit, die vollkommene Übereinstimmung erlangt. An dieser Stelle möchte ich mich auf die Ideen Poppers konzentrieren, die meine vollkommene Bewunderung und Anerkennung gefunden haben. Popper weiß, wie klar er redet und er teilt seinem Publikum, den Zuhörern von Vorträgen oder Lesern von Aufsätzen mit, dass es ihn viel Arbeit koste, sehr schwierige und komplexe Gedanken in eine klare und verständliche Sprache zu bringen. Er nennt Bertrand Russel als Vorbild, dessen Klarheit und Direktheit er verehrt, selbst wenn er Aussagen von ihm nicht teilt.
Die Klarheit von Popper - auch seine große Verachtung der Sprachverschmutzung durch gewollte Vernebelung in der Darstellung von Ideen, um Aufmerksamkeit zu erlangen oder aus Selbstgefallen heraus - fußt auf der Erkenntnis, dass Begriffe und Definitionen weniger wichtig sind als Theorien, um letztere gehe es. Eine Theorie könne richtig oder falsch sein, hier lohne sich die kritische Auseinandersetzung. Unsere Anzahl von Wörtern sei begrenzt, somit sei klar, dass die unendliche Fülle der darzustellenden Ideen eh nicht vollständig in jeder Nuance ausgesagt werden könne. (An dieser und an anderen Stellen hätte ich immer den Hinweis erwartet, dass Popper konkret die menschlichen Grenzen der Wahrnehmung oder des Verständnisses ausspricht, die Entwicklungsprozesse des Lebens und der Evolution hat er nämlich immer im Blick.) Zurück: Der Streit um Definitionen, Wortklaubereien seien zweitrangig, da im Gegensatz zur eigentlichen Auseinandersetzung mit den Theorien, Begriffe nicht so viel Schaden anrichten könnten. Wenn es gut läuft, sind die Begriffe adäquat, oder eben leider inadäquat - schlimmstenfalls aber höchstens irreführend. Daran kann man arbeiten. Der zweite Aspekt von Poppers Forderung nach sprachlicher Klarheit steht in Verbindung zu seiner Haltung der Bescheidenheit. Popper stellt dar, dass es kein Wissen gibt, es gibt Vermutungen, Vermutungswissen, das immer auf dem Prüfstand stehe und zurecht zu stehen habe. Oft fordert er dazu auf, sich von ihm nichts suggerieren zu lassen: "Glauben Sie mir kein Wort", fordert er. Wenn man sich aber eingestehen muss, dass es kein Wissen gibt, steht einem die Haltung der Bescheidenheit gut zu Gesicht.
Mit dieser Haltung schmälert Popper nicht die Errungenschaften der Erkenntnisse. Genau wie er für die Demokratie postuliert, sie sei - wenn auch nicht perfekt, gar mit großen Fehlern behaftet - die beste Staatsform, die wir besäßen, so kann er über die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse schreiben, dass es die besten seien, die wir bis dato gefunden hätten, sie seien aber eben nicht sicher, Vermutungen. Welche Qualität Poppers Gedanken haben, kann man tatsächlich kaum beschreibend darstellen. Er nimmt einen in den Texten mit auf eine Reise, die nach wenigen Sätzen eine Tiefe erreicht, die sich vom Alltagsgedankenfluss unterscheidet. Wenn er die Welt der menschlichen Gedanken, seine Welt 3, in ihrer Unabhängigkeit von der körperlichen Welt 1, also den Vorgängen im Gehirn, abgrenzt, ist das atemberaubend. Die natürlichen Zahlen wurden von Menschen gedacht, entdeckt. Sie gehören in diese Welt 3. Wenn wir über diese Dinge nachdenken, findet man auf der körperlichen Ebene Gehirntätigkeiten, also stehen diese Welten in einem Wechselverhältnis. Aus der Entdeckung der Zahlen leiten sich Beweise ab, z.B. der Beweis, dass es keine größte natürliche Zahl gebe - der Beweis fällt kurz aus: n+1. Auch der längere Beweis sei von Euklid erbracht, dass selbst die Reihe der Primzahlen nicht abreiße, auch wenn ihre Abstände größer würden. Noch nicht erwiesen sei, ob es eine größte Primzahl plus ihren um eine Zahl versetzten Zwillingspartner gebe, also in der Fortsetzung 3-5, 11-13, 17-19 usf. Es existiert also unabhängig von der körperlichen Welt der Gedankenleistung innerhalb der von Popper gedachten Welt 3 eine Lösung a oder b, die bis jetzt von der körperlichen Gehirntätigkeit losgelöst ist. Man muss ihm ja nicht zustimmen, der Gedanke ist aber klug - wenn vielleicht auch nicht in meiner verkürzten Darstellung.
Der Gedanke, der mich aber zu diesem "Schnipselchen" antrieb, ist ein anderer. Es geht darum, dass ich mit der Lektüre von Popper begriffen habe, wie sich beim Lesen das Denken vom Gelesenen lösen und ein seltsames Eigenleben gewinnen kann. Tatsächlich musste ich noch einmal nachlesen, ob mein Lieblingsgedanke zu Popper auch wirklich bei Popper stand. Er findet sich nicht, er ist der bewundernden Lektüre entsprungen ... vielleicht noch nicht einmal im Sinne des großen Philosophen aus mancherlei Gründen, die ich ja nicht verraten muss.
Popper stellt in seiner Auseinandersetzung mit der philosophischen Kernfrage des Leib-Seele-Problems dar, dass man davon ausgehen könne, dass bei aller Unwahrscheinlichkeit der Entstehung des Lebens (er zitiert Monod, der von einer Wahrscheinlichkeit 0 spricht) das Leben millionenfach entstanden sein könnte, bevor es zu den vorgefundenen Umweltbedingungen passte und dort an diesen andocken konnte. Leben, wenn es entsteht, braucht eine stabile Umgebung, die ein Weiterleben ermöglicht. Diese Umgebung braucht das Leben, das zu dieser Umgebung passt. Erst wenn ein entstandenes Leben zu der vorgefundenen Umgebung passt, kann eine Fortsetzung stattfinden. Diese doppelte Notwendigkeit ist also noch unwahrscheinlicher als der alleinige Ursprung von Leben selbst. Damit ist aber bereits im Anfang des Lebens die Idee einer Antizipation angelegt, die eine weitere Entwicklung ermöglicht. Neben meiner "eigenen" Erkenntnis, dass der Mensch innerhalb seiner Grenzen nicht alles wird erdenken können - ähnlich wie einmal bei den Pferden die Erkenntnisgrenze erreicht war (vgl. Schnipsel 21) - habe ich nach diesen Sätzen nicht mehr weitere philosophische Gedanken benötigt bzw. war oder bin an meinen Grenzen des Begreifens angelangt. In der Folge habe ich voller weiterer Bewunderungen nachgelesen, mit welcher Überzeugungskraft Popper den Wert der Freiheit darstellt, wie er fordert, diese Freiheit zu verteidigen, die immer Gefahr läuft, verloren zu gehen. Dazu gehört ferner die Erkenntnis, dass wir in der Verantwortung stehen, für eine bessere Welt mit unseren Handlungen einzutreten. Für die Gegenwart ist Popper Optimist: "Optimismus ist Pflicht", sagt er, auch wenn natürlich sich kein Optimismus für die (ferne) Zukunft als tragbar voraussagen lässt.
All diese Gedanken waren also von Popper in mein Bewusstsein gestreut. Wie er selbst sagt, ist unsere Interpretation von unseren Interessen geleitet, die Freiheit einzufordern liegt mir sehr - und sei es nur, um die Bürokraten zu ärgern, die an die ewige Pflichterfüllung appellieren um der Effizienz willen. Wie mutlos ist ein System, das den Glauben verliert, dass man Freiheit zulassen kann ...
Das war mein eigener Gedanke, ich habe ihn nicht mehr bei Karl Popper selbst gefunden, ich dachte aber bis vor kurzem, er sei von ihm: Wenn das Leben unter den oben beschriebenen Bedingungen seinen Ursprung hatte, dass ein unwahrscheinliches Anspringen von Leben stattfindet und zu der ihm passenden Umgebung passt, ist eine Fortsetzung möglich. In einer Reihe null = kein Leben und eins = Leben greift Leben und überlebt. Das bedeutet, dass der Wille zum Weiterleben konstruktiv in dieser Idee angelegt ist, wenn eins stattfindet. Wenn man dies auf eine Sprache überträgt, die die Begriffe gut oder böse verwendet, positiv oder negativ, konstruktiv oder destruktiv, so wird der Anspruch auf ein deutliches Übergewicht der einen oder anderen Seite hinfällig, da dem Überleben nur ein kleines Übergewicht von vielleicht 51 zu 49% reichen könnte, wenn auch vielleicht nicht auf ewig. Und wenn man dieses leichte Übergewicht des Positiven, Konstruktiven, Guten auf die Idee der Freiheit anwendet, könnte dieser auch die knappe Überlegenheit innewohnen, sonst hätte sie noch nicht so häufig knapp gewonnen. Darin liegt das eigentliche Potential für den Optimismus, einen Optimismus, der mutig sein könnte, die Freiheit zuzulassen, selbst wenn es den Missbraucht gibt. Wir sollten nicht auf denjenigen gucken, der vielleicht die Freiheit eines Systems ausnutzt, der sich von einer Gruppe tragen lässt - das gibt es bei Schülern und bei Lehrern - aber es überwiegen meiner Beobachtung nach deutlich diejenigen, die engagiert sind. Die Freiheit könnte es also ertragen und aushalten, wenn wir sie konsequenter zulassen würden. Gerade im Hinblick auf die Schule ließe sich da Vieles erkennen, bei Karl Popper klingt das so: "Denn es setzt eine Freundschaftsbeziehung zwischen Lehrer und Schüler voraus, bei welcher es jedem der beiden Teile freistehen müßte, sie fortzusetzen oder sie zu beenden. […] Und das Prinzip, daß wir jenen Menschen, die man uns anvertraut hat, vor allem nicht schaden dürfen, sollte in der Erziehung ebenso grundlegend sein wie in der Medizin." Warum sollte jemand mit 17 nicht entscheiden dürfen, ob er Mathematik oder Deutsch als Fach abwählen kann?
Foto rechts: Karl Popper (auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel zweiundneunzig: Johann Gottfried Herder
Von Herder habe ich wenig gelesen, es ist trotzdem sogar mehr, als ich dachte. Vielleicht war mir am Ende suspekt, dass ich bei ihm so viele Sätze fand, die meinen eigenen Überzeugungen oder kleineren Erkenntnissen - vielleicht etwas sperrig - gute zwei Jahrhunderte vor meiner Zeit seltsam nahe kamen. Selbst in den Kurzbiographien finden sich Hinweise, die ich gerne lese: Herder grenzte sich gegen aufkommende Rassebewertungen als Tendenzen in der Philosophie oder der Geschichtsbetrachtung ab, er befürwortete politische Veränderungen seiner Zeit wie die der französischen Revolution. Diese Aussagen kann ich nicht verifizieren, mittlerweile hinterfrage ich selbst meine eigene Haltung, der innewohnt, dass sich mit diesen Aussagen sogleich ein Wohlwollen meinerseits gegenüber einem Dichter oder Denker dieser Tendenz einstellte. In Anbetracht der Zweifel, einige markierte Zitate aus den Ideen zur Philosophie der Geschichte für sich:
Der Mensch ist zu feineren Trieben, mithin zur Freiheit organisiert
Unter den Trieben, die sich auf andre beziehen, ist der Geschlechtstrieb der mächtigste; auch er ist beim Menschen dem Bau der Humanität zugeordnet. Was bei dem vierfüßigen Tier, selbst bei dem schamhaften Elefanten, Begattung ist, ist bei ihm seinem Bau nach Kuß und Umarmung.
Jeden Tag hat uns der Schöpfer eine eigne Erfahrung gegeben, wie wenig alles in unsrer Maschine von uns und voneinander unabtrennlich sei: es ist des Todes Bruder, der balsamische Schlaf. Er scheidet die wichtigsten Verrichtungen unsres Lebens mit dem Finger seiner sanften Berührung.
Der jetzige Zustand der Menschen ist wahrscheinlich das verbindende Mittelglied zweener Welten.
Alles ist in der Natur verbunden, ein Zustand strebt zum andern und bereitet ihn vor. Wenn also der Mensch die Kette der Erdorganisation als ihr höchstes und letztes Glied schloß, so fängt er auch eben dadurch die Kette einer höhern Gattung von Geschöpfen als ihr niedrigstes Glied an; und so ist er wahrscheinlich der Mittelring zwischen zwei ineinandergreifenden Systemen der Schöpfung.
Gemälde von Johann Ludwig Strecker, Anton Graff und Gerhard von Kügelen (auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel dreiundneunzig: Sammy Davis jr. als Nachbar
Wenn ich mich besser auskennen würde, vielleicht meine Begegnungen früher stattgefunden hätten, wäre jeder der folgenden Personen eine eigene Würdigung zugekommen. Rosa Parks stand nicht auf in Montgomery 1955, Martin Luther King organisierte mit anderen den Boykott der Busse. Die größte Rede, die jemals gehalten wurde, folgte von ihm 1963: I Have a Dream:
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs
Das ist Schulwissen, vielleicht auch die Lektüre von Langston Hughes Gedicht: "I, too, sing America" als Antwort auf das Gedicht von Walt Whitman, oder John Henrik Clarkes Kurzgeschichte "The Boy who painted Christ black", auf die ich von meinem netten Kollegen Herrn Korell aufmerksam gemacht wurde. Ich weiß nicht mehr, wer mir Lorraine Hansberrys "A Raisin in the Sun" empfahl, die Auseinandersetzung mit diesem Theaterstück bleibt täglich aktuell. Den kleinen Link entdeckte ich zufällig. Frank Sinatra hatte eingeladen. Das Rat Pack tritt auf, das Publikum ist flithy rich und weiß. Dean Martin kommt die einstudierte Rolle des alkoholisierten fools zu, der preisgibt, auf die Aufforderung des Chefs Sinatra eingeflogen zu sein. Sein Zustand des "high-seins" ermöglichte das Einfliegen ohne Flugzeug. Es ist in einer Aufnahme aus dem Jahr 1965 aber Sammy Davis jr., der vor der perfekten Performance professioneller Unterhaltungskunst das Aufmerken in mir auslöst. Er steht vor brillant glitzernden Damen und befrackten Herren, er weiß, was es bedeutet, wenn Jazz-Größen schwarzer Hautfarbe nicht im gleichen Hotel übernachten dürfen wie ihre weißen Stars - das kennt auch Billie Holiday - doch vor diesem Publikum begibt sich Sammy Davis jr. auf einen Grenzgang. Der Slapstick droht immer zu kippen, z.B. wenn der Satz fällt, dass er die Witze, die über ihn gemacht werden, selbst auf die Bühne holt: I do it in self-defense ... Frank Sinatra habe gefragt, ob er komme, er habe Martin Luther King um Erlaubnis gefragt, ja er könne fahren, er würde immer auf den Marsch gehen, wenn es nötig sei, er sei auf einem Marsch bereits seltsamen Figuren begegnet, die Kopfkissen auf dem Kopfe trugen, glücklicherweise erreichte ihn noch die Warnung: "I think you're marching with the wrong people ..." Am Ende sei es wahr, "I am an American negroe", seine Mutter sei aus Puerto Rico, er selbst sei zum Judentum konvertiert: Wenn er, ein schwarzer Puertorikaner jüdischen Glaubens in eine Nachbarschaft ziehe, er würde sie ausradieren: "I'll wipe it out". (https://www.youtube.com/watch?v=GTI4ypSp_Gg)
In Lorraine Hansberrys Stück erfährt die Familie, was es tatsächlich bedeutet, in die scheinbar ordentliche Nachbarschaft einer gewünschten Rassenreinheit überzusiedeln. 2017 heißt der Nachbar in der völkischen Hetze in Deutschland Boateng.
Fotos: Bill Clinton mit Rosa Parks, Barack Obama im Bus des Rosa Parks Museums, Dr. Martin Luther King, Langston Hughes, Billie Holiday und Sammy Davis jr. sowie Jerome Boateng (auf Wikimedia Commons, public domain). Fotos von Lorraine Hansberry und John Henrik Clarke waren ohne Urheberrechtsbedenken nicht zu finden.
Schnipsel vierundneunzig: Heinrich von Kleists errötender Graf
Gegen Ende dieser Sammlung literarischer Sprengsel fällt die Aufrechterhaltung einer Assoziationskette schwerer, die Übergänge werden kontrastreicher. Die letzten Ideen, die auf meinen Zettelchen stehen und noch nicht durchgestrichen wurden, sperren sich aus unterschiedlichen Gründen. Sie sind zum Teil jünger, weniger vernetzt, weniger vertieft, oft nur skizzenhaft in meiner Erinnerung hinterlegt. Der Zweifel meldet sich, wenn mir nicht klar ist, ob eine Beobachtung eine wirkliche Bedeutung für mich hat oder aber ihr nur eine boulevardhafte Anekdote innewohnt. Manchmal, wie im Falle Kleists, scheinen mir die einzelnen Facetten zu flirrend zu sein, um sie tatsächlich in einen in sich nachvollziehbaren Gedankenfluss zu bringen. Kurt Tucholsky ringt 1929 einmal mit einem Gedanken und findet dabei das Wort, das ich gerade gebrauchte: "Ich werde ins Grab sinken, ohne zu wissen, was die Birkenblätter tun. Ich weiß es, aber ich kann es nicht sagen. Der Wind weht durch die jungen Birken; ihre Blätter zittern so schnell, hin und her, daß sie... was? Flirren?"
Auf einer Homepage zur Geschichte des Brandenburger Tores findet sich der Satz, dass zwischen 1814 und 1919 nur Mitglieder der königlichen Familie und Mitglieder der Familie Pfuel das Privileg besaßen, durch das Brandenburger Tor zu fahren. Pfuel war ein Held, ein Militär, der beeindruckte in der Schlacht von Waterloo. Es findet sich in mehreren Sprachen immer wieder der Hinweis, dass er für die Rückholung der Quadriga nach Berlin aus Paris verantwortlich war. Napoleons Niederlage, Preußens Erstarken findet sich in diesem Bild. Dieser Ernst von Pfuel gilt als Erfinder des Brustschwimmens. Er lehrte das Schwimmen wie Jahn das Turnen. Irgendwie scheint sich in ihm preußische Potenz zu konzentrieren, nach sechs Kindern mit Ehefrau eins, die Scheidung und eine neue Ehe usf. Ich kenne diesen Menschen nicht, werde niemals sein Leben auch nur im Geringsten betrachten, bewerten oder erinnern. Selbst die Schnittmenge, die es mit dem Leben von Heinrich von Kleist hat, werde ich nur zur Kenntnis nehmen, weil ich kein Experte für Kleist bin und mir nicht vornehme, einer zu werden. Kleist bringt sich 1811 zusammen mit Henriette Vogel am Kleinen Wannsee um. Die Todesumstände sind zum Teil stärker im Focus als Kleists Texte, die Spekulationen enorm. Wir haben von Georg Heym bereits gehört, dass er zum Grab Kleists ging (vgl. Schnipsel sieben). Heinrich von Kleist war ein Suchender, er hätte sich eine Ankunft im Preußentum vorstellen können, die normgerechte Inszenierung seiner Adelskarriere hätte ihn hierin berufen gesehen. Es funktionierte nicht. Er lässt sich nicht festlegen. Er findet keine Wohnung, reist quer durch Europa, immer mit neuen Visionen. Es gibt wohl Hinweise, dass er ein preußischer Spion war, ich glaube auch mich daran zu erinnern, dass er einen Biobauernhof in den Alpen ins Leben rufen wollte. Überlebt haben seine Texte, die Versuche, Schriftsteller zu sein. In der Liebe scheint er bis zum Schluss zu keiner tragfähigen, vom Ballast des extremen Anspruchsdenkens befreiten Beziehung fähig - der inszenierte Selbstmord in Blickweite des preußischen Königsweges scheint dafür sinnbildlich. Eine Facette von Kleist ist in seinen Briefen dokumentiert. Der Liebesbrief an Ernst von Pfuel wurde von diesem nicht vernichtet. Betrachtet man die Lebensläufe dieser beiden Männer, gewinnt dieses Dokument sicherlich ein enormes Spekulationspotential, wobei im Leben Kleists das tragische, bei Pfuel das heroische Moment überwiegt. Worum kann es am Ende gehen? Vielleicht geht es um das, was überlebt hat: Im Falle Pfuels stehen eine vierrössige Kutsche auf einem oft fotografierten Torbogen und Siege auf den Schlachtfeldern Europas. Im Falle Kleists gibt es Texte, mit denen sich viele Schülerinnen und Schüler bis heute nicht ganz freiwillig herumschlagen müssen, einige verzaubert aber dieser Dichter mit seinen seltsamen Charakteren bis heute, z.B. mit dieser starken Frau, die einen Weg findet, für alles zu kämpfen, was sie in ihrem Leben für wichtig erachtet und am Ende alle Skeptiker von ihrer Rechtschaffenheit überzeugt - oder dem Charakter des Grafen, des Obristleutnants, den der Trieb übermannt, der die zu rettende Dame vergewaltigt, den der Gewissensbiss heimsucht, der im Erröten und Stammeln, in der ewigen Gefahr der lauernden Ohnmacht strauchelt und seinen seltsamen Weg aus der Misere findet. Nicht so heldenhaft und klar wie die Marquise, aber immerhin. Und wenn ich für Kleist und seine Texte, diese präzise, im Duktus der Eindringlichkeit verfassten Prosa ein Wort finden müsste, wäre es vielleicht der englische Begriff erratic.
Fotos außen: Ernst von Pfuel (links) und Heinrich von Kleist (auf Wikimedia Commons, public domain); Mitte: Die Quadriga auf dem Brandenburger Tor ((c) Stefan Scheffler).
Schnipsel fünfundneunzig: Langston Hughes Nachtrag
Das Gedicht "I hear America Singing" stammt von Walt Whitman. Auch hier steckt allein in der Nennung des Namens ein seltsamer Kontrast bzw. in der Kontrastierung ein seltsamer Zufall. Langston Hughes vereinigt Schattierungen und Nuancierungen und die findet man in seinem Gedicht, das ich bereits oben kurz erwähnt habe: "I, too, sing America". Er sei der dunklere Bruder, der, der in die Küche geschickt werde, wenn Besuch kommt. Aber er werde lachen, gut essen und am Ende stark werden. Irgendwann habe er die Stärke erreicht, dass man ihn nicht mehr wegschicke: "Besides, / They’ll see how beautiful I am / And be ashamed - I, too, am America."

Foto: Langston Hughes (auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel sechsundneunzig: Die Erdigkeit von Jean-Baptiste Adamsberg
In Friedrich Gottlieb Klopstocks Frühlingslied singt es:
Nicht in den Ozean der Welten alle
Will ich mich stürzen! schweben nicht,
Wo die ersten Erschaffnen, die Jubelchöre der Söhne des Lichts,
Anbeten, tief anbeten! und in Entzückung vergehn!
Nur um den Tropfen am Eimer,
Um die Erde nur, will ich schweben, und anbeten!
Halleluja! Halleluja! Der Tropfen am Eimer
Rann aus der Hand, des Allmächtigen auch!
Der Begriff "Epiphanie" drückt das Auftreten der Gottheit aus, z.B. wenn sich die Nähe des Schöpfers durch einen Gedankenblitz äußert, wenn sich also wie aus dem Nichts oder den fernen Teilen der Welt 3 ein Fünkchen im Begreifen weiter unten zeigt, z.B. in den Hirnregionen des Einzelnen. Goethe findet in seinen "Zahmen Xenien" Worte für die zarte Bindung, vielleicht der Korrelation zwischen den dem Dort-Weit-Entfernten und seinem Rezeptor auf der Erde:
Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?
Fred Vargas hat mit ihrem Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg eine beeindruckende Persönlichkeit geschaffen. Er ist eher klein, seltsam ledern, immer erdig. Das Denken fällt ihm schwer, intuitiv begreift er, bevor die Klarheit der Analyse den konkreten Weg ebnet. Er stammt aus den Pyrenäen, in Paris wirkt er oft am falschen Ort. Trotzdem verortet er sich in einem alten Haus ... oder auf Wegen, die ihm etwas Grün oder Boden unter den Fuß bringen. Es sind aber zwei Dinge, mit denen die Autorin Fred Vargas ihren Kommissar ausgestattet hat, die ihn zum Energiequell für die Leser von ihm machen. Er ist tatsächlich unerschrocken. Nach einer wonnigen Nacht in einer Matratzenmulde, die den Wahn einer geraden nächtlichen Wirbelsäule als Farce entlarvt, ist er gerüstet, jedem Aberglauben, jeder Gefahr des unüberprüften Mythos die Stirn zu bieten, zum Beispiel im Band "Die Nacht des Zorns". Es war einer jener Epiphanie-Momente des Lesens, als mir Adamsberg mit diesem Wesenszug vorgestellt wurde, dass ihm die Angst ein unbekanntes Gefühl sei. Selbst die Autorität der Bürokratie besitzt über den Kommissar keine Macht, eher die Erkenntnis, dass sich die Kühe in der Normandie tatsächlich nicht bewegen. Der zweite Wesenszug, mit dem Adamsberg von seiner Schöpferin ausgestattet wurde, ist tatsächlich sein stoisches Einfordern von Sonderwegen. Während der scheinbaren Auszeiten haben die Gedanken Zeit zu reifen, das Aufsteigen an die Oberfläche eines fassbaren Begreifens braucht Zeit. Frederique Vargas zelebriert die Erkennenswege ihres Kommissars. In "Fliehe weit und schnell" ist es der mehrfache Weg an die Seine, dort das Spiegeln des Lichts in den Tropfen bzw. Wellen des Wassers, das die Wahrnehmung schärft, um am Ort der Entscheidung, am Ort der geballten Zusammenkunft den Blick durchlässig zu haben für das sinnliche Eintreffen des Lichtstrahls einer winzigen Reflektion ... es ist das Glitzern eines Ringes: "Es war ein sehr viel kleinerer Blitz, winzig klein und weiß, so wie die kleinen Wellen heute abend und sehr viel flüchtiger [...] Adamsberg stand auf und holte tief Luft. Er hatte ihn. Das Funkeln eines Diamanten ..."
Natürlich ist Klopstocks Tropfen am Eimer größer als der Clue in einem Kriminalroman, die Freude, die Besonderheit des Moments wahrnehmen zu dürfen, dem man sich mit Muße nähern durfte, ist universell ähnlich, hoffe ich.
Fotos: Friedrich Gottlieb Klopstock, gemalt von Elisabeth Vogel, Wassertropfen und Fred Vargas. (Fotos von Klopstock und den Tropfen auf Wikimedia Commons, public domain) Fred Vargas von Marcello Casal/ABr: Fred Vargas redux (CC BY-SA 3.0).
Schnipsel siebenundneunzig: Vorhang der Pupille
Im Rückgriff auf das Gedicht "Der Panther" von Rainer Maria Rilke findet sich ein kleines Detail, das sich mit dem Eintreffen der Welt auf die Seele in Verbindung bringen lässt. Was ist der Vorhang der Pupille? Ich habe noch kein Urteil für mich gefällt, meine Schülerinnen und Schüler verteidigen oft klug und stimmig das Lid, nur meiner subjektiven Vorstellung, wonach sich ein Vorhang - auch im Theater - zur Seite hin wegbewegt, verdanke ich mein aufsässiges Festhalten, wonach Rilke die katzenhafte Besonderheit der vertikalen angeordneten bikonvexen Form der Pupille im Blick gehabt haben könnte.
(c) Stefan Scheffler
Schnipsel achtundneunzig: Elijah
Fast alle Ideen und in den ersten Texten gemachten Andeutungen sind mittlerweile in dieser kleinen Sammlung verarbeitet. Es wurden also ca. 100, nicht 80. Bleibt noch ein Vorvorletztes. Elijah oder Elias klingt seltsam sympathisch. Es ist der alttestamentliche Prophet, dessen Wagen von mächtigen Feuerrossen Richtung Himmel gezogen wird. Zu diesem Propheten werde ich noch viel lesen müssen, selbst die musikalische Bearbeitung - sie feierte in England ihren größten Erfolg - im Requiem von Felix Mendelssohn - kenne ich nicht. Elijah kenne ich als kleinen Handzettel, der x-mal Leopold Bloom um die Füße geweht wird oder unter ihm auf der Liffey in die schneuzgrüne Irische See driftet. Die Ankündigung des Flugblatts, dass Elijah kommt, findet in Ulysses in einem späteren Kapitel den Auflösungshinweis, es geht um einen kauzigen Wanderprediger, Heilsbringer, Gesundheitsstifter namens John Alexander Dowie, der wohl in Dublin 1904 gewesen sein könnte, es wohl aber nie war. Sei's drum. In Dublin nahm ich mir vor, noch einmal in die Trinity Library zu gehen. Es konnte nicht anders sein, als dass ein kleines Flugblatt in einer Vitrine am Eingang Elijah ankündigte. Irgendwann werde ich über diesen Zusammenhang noch einmal nachdenken, an dieser Stelle ist der letzte Schnipsel in all seinem Fragment-Charakter eingeklebt, der Kreis ziemlich geschlossen.
Bild links: Moritz Oppenheim: Mendelssohn plays to Goethe (auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel neunundneunzig: Paulchen Panther meets Inspector Columbo
Es gibt Namen, die in ihrem Klang und in der Erinnerung, die sie auslösen, ein absolutes Wohlfühlpotential haben. Seltsamerweise verzeiht man einigen der Charaktere dieser Namen ihre Wuschigkeit, ihren odradekhaften Unordentlichkeitsstolz, ihre gelassene gewaltfreie Chaoszufriedenheit. Sie sind Sinnträger davon, dass es auch anders geht. Sie müssen immer etwas unbequem stachelig, schmuddelig oder widerspenstig sein. Die Tiefe ihrer Herzlichkeit ist noch nicht kieselrund gespült im Bächlein der Anpassung. Sie sind immun gegenüber der Prussliesigkeit der hierarchisch organisierten Rechtwinkligkeit - sie sind vielleicht das eine Prozent mehr, an dem das schnoddrige Leben mit seiner Idee des Entwicklungspotentials andocken konnte. Zwei haben in diesen vorletzten Schnipsel gefunden: Paulchen Panther versucht es einmal, das schiefhängende Bild gerade zu rücken, er scheitert wie Loriot im Wohnzimmer der Telleranrichten. Die Liedzeile "Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät ..." wird am Ende jeden von uns treffen, wohl dem, der in der Hoffnung aufgehoben ist des letzten Verses: "Heute ist nicht alle Tage, ich komm' wieder, keine Frage ..." Columbo brauchte auch immer noch einmal die eine Wendung zurück, die Hand von der Stirn in Richtung des sich in falscher Sicherheit glaubenden Übeltäters richtend, wobei die Finger in aller Entspanntheit nie den Fehler des anklagenden Draufzeigens machten.
Ich warte noch auf eine Antwort auf meine Anfrage bei MGM, wahrscheinlich ist Paulchen größer als Herr Tur Tur. Foto rechts: Peter Falk (auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel einhundert: Die Gelassenheit der Alten
Manchmal kann man von den Alten die Abgrenzung lernen, die Unaufgeregtheit. Meine zwei Großväter waren beide am Arm verwundet. Der eine saß in Moischt, der andere in Berlin. Die Beredtheit und augenzwinkernde Schläue des einen bekam ich nur selten zu Gesicht. Das Schweigen des anderen ... genauso häufig, genauso selten, seltsam, dass beides Sinn macht. Mein Opa in Moischt hat mir ohne viele Worte den ersten Pott Kaffee hingestellt mit einem Tropfen Kaffee, viel Milch und noch mehr Zucker. Wenn ich in meiner Wonne glücklich war, saß ich schweigend neben ihm, wenn er die Zeitung las. Wenn man ihn dann aber noch einmal ansprechen wollte, gab es den Donner der Worte: "Liss mir mei Rouh." Mein Schwiegervater sagt manchmal: "Ich mein, es täte mal schicke." Im Wesen zwei sehr freundliche Menschen, wenn man es genauer überlegt ...