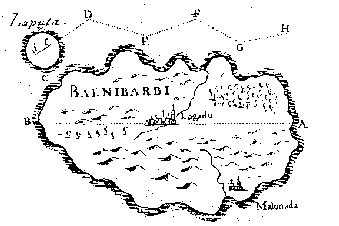Schnipsel 201 Binsenweisheit
William Turner: Ovid Banished from Rome, 1838 (auf Wikimedia Commons, public domain).
In Andreas Steinhöfels Jugendroman "Die Mitte der Welt" entdeckt der siebzehnjährige Phil an entfernter Stelle des riesigen Gartens der im Zerfall begriffenen Villa seiner Kindheit, nur zaghaft angedeutet durch den Fingerzeig einer Engelsstatue mit Schwert, einen ewig tiefen Teich schwarzen Wassers. Viel Überwindung kostet ihn das Eintauchen in diese dunkle Flüssigkeit nur zu ahnender Bodenlosigkeit; und er erzählt niemandem davon, nicht einmal seiner Zwillingsschwester oder vertrauten Freundin Kat. Es sei ihm schon damals als Kind bewusst gewesen, dass jeder Mensch ein Geheimnis brauche.
Immer wenn ein Rätsel zu lösen, ein Abgrund zu ergründen oder eine Unbegreiflichkeit zu meistern ist, wird der Entdeckereifer oder das Jagdfieber des wachen Geistes entfacht, so einfach kann Literatur oder Erzählfreude ihre Köder auswerfen und ihre Leser in den Sog ihrer erahnbaren Erkenntnisgröße ziehen. Selbst Chaucers über 600 Jahre alten "Canterbury Tales" gelingt dies, wenn die Frau aus Bath mit ihrer rauchigen Stimme (sie ist rauchig, believe me) zu ihrer Erzählung vor den gespannten Mitpilgern ansetzt. Ihre Wahrheiten sind unbequem. Sie bekennt sich zu ihrem Verlangen nach erfüllter Sexualität oder ihrer Abneigung gegenüber Bevormundung. Man könnte ihr vorwerfen, die Stimme des männlichen Erzählers zu sein, die man meint in manchem Klischee herauszuhören, wenn es z.B. um Schwatzhaftigkeit oder weibliche Nörgelei geht oder eben auch um das große Rätsel, das der Ritter ihrer Erzählung knacken muss. Die Aufgabe für ihn ist, herauszufinden, welcher universelle Wunsch allen Frauen gemein ist; löst er die Aufgabe der Königin nicht, droht Ableben. Es geht mir an dieser Stelle weniger um die Lösung, als um den meisterlich eingefädelten oder auf den Weg gebrachten Ansporn, weiter die Seiten um- und umzublättern, da man diese Erkenntnis selbst gerne für sich gewinnen möchte. Einen Vers zum Anködern liefere ich gerne, er verweist aber nur auf den nächsten, der die vollständige Antwort liefert auf die Frage, was alle Frauen anstreben:
"Wommen desire to have sovereynetee …"
Soweit die Vorrede. Das Bild, mit dem dieser Schnipsel eingeleitet wird, deutet auf das viel größere Rätsel hin, das bereits in Text 199 angelegt war, warum Ovid - der sich seines literarischen Ruhms und Nachruhms so sicher schien - in die Verbannung musste? Mit der Fährte, auf die Christoph Ransmayr seine Leser schickt, findet man im Text etliche schlüssige Beweise dafür, dass sich ein despotischer Machtanspruch durch seine, Ovids dichterische Ausgestaltung des alten griechischen Sagenstoffs in Gefahr wähnen musste. Der Dichter wird zum Staatsfeind; Kaiser Augustus hatte zu handeln, indem er den Sänger steter Wandlung und Veränderung ans Ende der Welt verfrachtete. Ovid, der bessere Teil von ihm (vgl. 199), war sich seiner Überlebensfähigkeit bis in alle lebendige oder lesende Ewigkeit bewusst.
Mich erreichten Ovids Metamorphosen über den Text der Frau aus Bath, es reichte ein Wort, eine damit verbundene Geschichte, eine Erklärung in einer Fußnote in der zweisprachigen Reclam-Ausgabe der "Canterbury Tales": Binsenweisheit …
Eigentlich weiß es jeder. Es ist fast der Rede nicht wert. Die Redewendung, es sei eine Binsenweisheit, ist bis heute in Zeiten der Dauerbeschallung allgegenwärtig. Ovid lässt sich meiner Meinung nach viel Zeit, bis er seine Episode im 11. Buch positioniert und ausgestaltet. Viele kleine Motive kann man als Verweise, Ankündigungen oder Vorläufer sehen. Landschaften mit "schwankenden Weiden, dürftige[m] Riedgras, sumpfliebenden Binse[n], Gesträuch und niederes Schilf unter hohem Röhricht" ("Die Jagd auf den kalydonischen Eber") oder die Beschreibung der Entdeckung Pans, dass der Wind dem Röhren von Schilf Töne entlockt, die Panflöte wird ihm zum Ersatz für die flüchtige Nymphe ("Pan und Syrinx"). Gerhard Kaidisch hat einen Aufsatz hierzu veröffentlicht ("Die Binsenweisheit, Ovids Barbier des Midas und die Syrinx".)
Also, Rohrflöten mit gefälligem Gezwitscher finde früh Einzug in Ovids Metamorphosen. Den konkreten Hinweis auf Ovids große Dichtung und hier insbesondere auf die Geschichten des unmöglichen Schweigens lieferten mir aber Chaucers Verse:
Ovyde, amonges othere thynges smale,
Seyde Myda hadde, under his longe heres,
Growyinge upon his heed two asses eres …
Der Herrscher Midas - wer wird sich hierüber ärgern - ist nicht mit besonderer Cleverness gesegnet. Er geht der Versuchung in die Falle, sich von der Gier leiten zu lassen, nachdem ihm von einem Gott die Erfüllung eines Wunsches gewährt wird: Alles möge sich in Gold verwandeln, das er berühre, wie dumm von ihm. Ovid lässt das Opfer aus, das die Berührung der eigenen Tochter bedeutet, er konzentriert sich auf den unstillbaren Hunger, der sich aus der Tatsache ergibt, dass einmal angerührte, damit vergoldete Nahrungsmittel nicht mehr sättigen. Wie selten wird dem Tor eine zweite Chance gewährt, doch leider läuft Dummheit und Gier öfters Gefahr, auch ein zweites Mal trittsicher ins falsche Näpfchen zu treten. Das laue Spiel der Rohrflöte eines Hirten ist im Vergleich zum göttlichen Klang der Stimme und Gitarre Apollos selbst zu bewerten. Midas bevorzugt (- in der Übertragung von Gerhard Finks hört sich das so an: "Stumpf aber blieb sein Verstand." -) die gefällige Flöte und brüskiert damit den göttlichen Klang Apollos, eine Rache lässt bei Ovid nie lange auf sich warten: Midas werden kurzerhand die Ohren zu Eselsohren langgezogen, für die er sich arg schämt. Die Hybris Pans, den Versuch des musikalischen Wettstreits zu suchen, scheint gegenüber der misslichen Entscheidung des falschen Hörens sogar kaum der Strafe zu bedürfen.
Ein langer Mittelteil nach langer Vorrede. Midas will sein Geheimnis der langen Ohren um jeden Preis verbergen. Ich selbst kann kein Geheimnis länger als kaum wenige Stunden für mich behalten, deshalb ist mir der Barbier bei Ovid (in Chaucers Erzählung von der Frau aus Bath ist es die Königin und Gefährtin des Herrschers selbst) so sympathisch. Der Barbier hat beim Haarschnitt die so akribisch unter Haar und Mütze versteckten Ohren entdeckt. Er müsse das Geheimnis in jedem Falle für sich behalten … und kann es nicht, sonst würde er platzen!
Listig ersinnt er den Plan, seinen inneren Ballast auf Umwegen loszuwerden, tut am See ein Stückchen Erde auf und brüllt sein Wissen um die Zeichen der Fehlbarkeit des Herrschers, sein auferlegtes Verbot in den scheinbar akustisch dichthaltenden Schlamm hinein. Niemand behält ein Geheimnis für ewig, auch der fruchtbare Boden nicht. Dichte erdige Kanäle bieten nur kurzfristigen Schutz, um den einmal freigelassenen Schall zu dämmen. Jedes Versteck hat eine Halbwertszeit, dann doch besser raus damit, denkt sich auch die schwitzende Erde und gibt das Geheimnis weiter. Erst wächst mehr Binsengestrüpp um den See, dann fängt es an, die in Verschluss geglaubte Botschaft auszuschwitzen an Ohren, die nach einer Mitteilung nie gefragt haben. Oder entspannter im übersetzten Originalton: "Vom linden Südwind durchsäuselt, wiederholte es die begrabenen Worte und warf dem König seine Eselsohren vor" … alle konnten es hören im Schlendern am See.
Warum wurde Ovid verbannt? Es ist die Schlüsselidee, die Christoph Ransmayrs Roman "Die letzte Welt" motiviert, und wie bei Chaucer überlebt Ovidius Naso in ihm und schließlich durch ihn selbst.
In der Episode "Die Weberin" maßt sich Arachne einmal an, besser spinnen zu können als die große Athene, Göttin wirkender Hände. Arachnes Gewebe ist eine "Anklage an die Schande der Götter", ihre Darstellung ist makellos, es ärgert sich die Meisterin, deren Motivik das große Lob auf die bestehenden Verhältnisse zeigt. Athene wird zornig und sie hat die göttliche Macht, vernichtend zu strafen. Vielleicht eine Ahnung, wie die Strukturen funktionieren, die ausbürgern, verbannen oder sonst was können. Eine Idee, kein Beweis, keine Lösung … nur aktive, echte Rätsel besitzen das Potential, zu überleben.
Bleibt nachzutragen: Der große Erfinder Daidalos ordnet die Federn für seine und Ikarus Flügel in der Form und Anordnung der Hirtenflöte an. Auch Ovid webt.
Adam Pynkhurst ...
(c) Stefan Scheffler
Schnipsel 202: Der große Plan
(c) Stefan Scheffler
Es ist der Weisheit letzter Schluss, mit der ich Dragoslav Stepanovic in Schnipsel 190 zitiere: Das Leben geht weiter. Da wo Stepanovics Weisheit aufhört, fängt der Okkultismus an. Ausladend umfassend widmet sich Umberto Eco in seinem großen Roman "Das Foucaultsche Pendel" den großen Rätseln, den Mystikern und tief Suchenden. Die große europäische Hatz nach dem Heiligen Gral lockt einmal mehr. Die Vertreter aller Grenzregionen der Geheimniskrämerei, religiös oder spirituell oder existentiell motiviert, geben sich in diesem Roman die Klinke ihrer jeweils verschlossenen Pforte in die Hand. Die Seher und Verführer, Bewahrer und Tradierer, alle ruft Umberto Eco auf die große Bühne: Die Templer, Freimaurer, Rosenkreuzer, Hermeneutiker, Hermetiker, Alchimisten, Mystiker, Kabbalisten, New-Ager, Initiierte und Mystiker ... und die drei Gelehrten eines Mailänder Verlages Jacopo Belbo, Diotallevi und Casaubon geraten in den erst leichten, doch dann sehr gefräßigen Sog der Aufdeckung des großen Plans ...
Das Artur Rubinstein zugesprochene Zitat auf die Frage, ob er an Gott glaube: "Nein, ich glaube an etwas viel Größeres" ist eine würdige Verdichtung der Thematik, mit der Eco an einer Stelle mit dem Spiel der doppelt und mehrfach versteckten Heimlichkeit jongliert. Es sind die drei männlichen Intellektuellen, die - jeder auf seine Weise - der Gefahr erliegen, die Ebene der beobachtbaren Erkenntnisse zu verlassen ... und Eco zeigt die Muster und Regeln, nach denen dann gespielt wird, er zeigt auch das Wesen der Wege, die sich dort öffnen, wo die Luft dünn und esoterisch wird. Wieso verlischt die menschliche Sehnsucht nicht, verbotene oder gar unmögliche Einsicht gewährt zu bekommen? Es ist die Macht der Überlieferung, der alten Geschichten, die tiefere Wahrheiten versprechen als das, was dem Menschen eigentlich auf den ersten Blick offensteht. In diesen Geschichten lebt der Mythos, geht das Sagenhafte nie verloren; es sind diese Geschichten, die uns Menschen seit Jahrtausenden antreiben, zu graben und zu fliegen, in der Hoffnung das große Warum zu knacken. "Erzählungen sind Fakten des kollektiven Imaginären", schreibt Eco.
Jedes Kapitel wird mit Zitaten aus dem großen Dunkel-Kanon eingeleitet - z.B. 113 des Imams Ga'far al-Sadig:
"Unsere Sache ist ein Geheimnis in einem Geheimnis, das Geheimnis von etwas, das verhüllt bleibt, ein Geheimnis, das nur ein anderes Geheimnis erklären kann, ein Geheimnis über ein Geheimnis, das sich mit einem Geheimnis befriedigt."
Lia, Casaubons Freundin, ist diejenige, die ihren Mann erdet und ihm mit seiner bzw. ihrer gemeinsamen Tochter bezeugen kann, worin das erkennbare letzte Geheimnis für den Menschen besteht, das Wunder der Prokreation. Sie ist es, die der komplizierten Codierung einer mysteriösen Templerbotschaft den profaneren Sinn eines Einkaufszettels entnehmen kann, doch der Leser selbst bleibt mit den Protagonisten im Strudel der Entdeckungsreise, Ecos Fluss seiner großen Prosa besitzt die Macht, den Leser an die einmal angefachte Neugierde auszuliefern. In diesem Fluss treibt man oder blättert man Seite um Seite um in der Hoffnung, selbst der Lösung und damit der Weltherrschaft näher zu kommen. Mit dem Erwachen Casaubons allerdings gelangt er zu Momenten tiefen Verstehens okkulter Mechanismen: Ein kluges Auflösen der geistigen Gefangennahme wird eingeleitet durch ein Zitat Karl Poppers: "The conspiracy theory of society ... comes from abandoning God and then asking: 'Who is in his place?'" Bereits im 33. Kapitel erklärt ein wichtiger unsterblicher Herr den Unterschied zwischen dem Mystiker als Mitgerissenem, und dem Initiierten, dessen langer Weg in das Reich tieferer Wesensgründe oder Daseinszustände ihn die Zusammenhänge des Verborgenen mit größerer Distanz erleben lässt. Die Elite der Weltherrscher - so der Gedanke - sei initiiert. An der Stelle, an der das oben erwähnte Rubinsteinzitat steht, offenbart sich die vermeintlich letzte Erkenntnis, die man einem Geheimnis über eben den Weg der Initiation entnehmen kann. Das letzte Geheimnis ist ein Geheimnis ... ich glaube, ich verrate es nicht, es steht früh im Jessod Teil. Dieses letzte Geheimnis erfüllt nicht, sättigt nicht. Einer der Charaktere erkennt am Ende, dass mit der Idee der Nächstenliebe eines der fruchtbringendsten Schlüssel zur gesellschaftlichen Blüte in die Welt gesetzt worden ist, hier dockt die Weisheit des Lebens an, da wo sie endet, beginnt das Reich der Verführer.
Umberto Eco lässt den Roman dort enden, wo er mit der Rahmenhandlung, des Besuchs des "Musée des Arts et Métiers" in Paris, beginnt. Dort hängt das große Pendel, mit dem die Erdrotation bewiesen werden konnte, das Pendel, das einen Fixpunkt braucht, einen Punkt im All, der stet ist. Bereits auf der ersten Seite, für die man sich mit Wonne Zeit lassen muss, konstruiert Eco, wie sich Einheit, Zweiheit und die mächtige Dreizahl im Wesen des Pendels vereinen. Später begreift er am Schicksal von Jacopo Belbo, dass der Fixpunkt der Welt den glücklichen Menschen in dem Moment bewusst wird, in dem sie ihn erfahren, die Mitte ihres Lebens und Erlebens, den einen Moment, an dem ihr eigenes Leben aufgehängt ist, für Belbo war es ein Trompetenton, den er während einer Beerdigung seinem Sehnsuchtsinstrument ungeahnte Dauer verleihen konnte, ein Moment, in dem sich auch die Sehnsucht zur Liebe erfüllte.
Mit Augenzwinkern wollte ich an dieser Stelle auf Geheimnisse hinweisen, die man auch zu unserer Zeit kaum für möglich hält. Sollte es in unserer Gegenwart möglich sein, dass sich alle Herrscher der Welt aus Politik, Wirtschaft und Journalismus tatsächlich regelmäßig an geheimen Orten treffen unter den zum Teil daran teilhabenden Augen der Medienmacht, einer Vereinigung, dem ein belgischer Küstenort ihren Namen gab. Ich lass es, selbst die Bilderberger haben mittlerweile ihren Homepageauftritt und sind aus ihrem Nebel etwas hervorgetreten. Schreiben möchte ich zu einer Kleinigkeit, einem Detail, die dem Format der Schnipsel und Nebenpfade gerechter wird. Dreimal lugt aus Umberto Ecos Roman T.S. Eliots kryptischstes aller kryptischen Gedichte "The Wasteland" hervor. Der mittlere Verweis auf das Gedicht erfolgt über die Verszeile: "I can show you fear in a handful of dust". Bei Ovid war eine ähnliche Geste, eine Handvoll Sandkörner zu zeigen, mit der Bitte verbunden, einen Aufschub von vielen Jahren gewährt zu bekommen, bevor das Leben versiegt. Die Bitte wird der Seherin Cumae erfüllt, sie hätte allerdings die Konsequenzen des Alters in ihren Wunsch miteinbeziehen müssen. Selbst dort verweist also die große Geste auf die Angst, der wir uns als Sterbliche aufgrund der letzten Ungewissheit ausgesetzt sehen. So verweist Eco über Eliot auf die große Bedeutung menschlicher Anfälligkeit, alle nur möglichen Wege einzuschlagen, die eine Überwindung oder Vermeidung dieser letzten Angst in Aussicht stellen. Nur der Wachsame wird die Fähigkeit behalten, im Leben selbst vielleicht nicht den Trost, aber zumindest seine unausweichliche Aufgabe zu begreifen, vielleicht auch die dann doch tröstliche Erkenntnis, dass er bereits Teil und Antwort des größten Mysteriums ist.
Über Tiresias, dem Seher bei Ovid und T.S. Eliot, müsste ich noch mal nachdenken ...
Fotos v.l.n.r.: Herzlichen Dank an Stefan Matlik, der in den "seeehr" spätesten 1980er Jahren das Buchcover mit der umgekehrten Ikonographie eines Schreibers zu Umberto Ecos "Das Foucaultsche Pendel" für den "Deutschen Bücherbund Stuttgart" entworfen hat, und mir freundlicherweise die Veröffentlichung gestattete - danke für den prompten und netten Kontakt. In der Mitte das Foucaultsche Pendel im Musée des arts et métiers von Ewout ter Haar: Foucault pendulum at the Musée des arts et métiers, 2010 (CC BY 2.0). Das gleiche Motiv von Jean Champion: Pendule de Foucault (CC BY 3.0). Mit dem letzten Blickwinkel wird die Perspektive deutlich, den Fixpunkt des Universum im Schwung der Bögen der Kirche zu ahnen.
Fotos: (c) Stefan Scheffler - Wenn man in Hessen Spuren der Templer sucht, gelangt man zum Ort Homberg. Vom Schloss sieht man auf den katholischen Felsen der Amöneburg ... Bonifatius markiert den ersten Schritt zur Legende, die Glaubensgrenze nur wenige Meter entfernt ist bis heute erlebbar. Die Feste war eine Bastion des katholischen Erzbischofs von Mainz.
Fotos: (c) Stefan Scheffler - v.l.n.r.: Eine tausendjährig Eiche vor dem Schlösschen in Homberg, ein Grabstein mit dem Auge Gottes in der Kirche auf der Amöneburg, das Motiv in einer nahe gelegenen Klosterkirche, Kreuz vor dicken Mauern - mit etwas Phantasie könnte eine verschwörerische Theorie ihren Ausgangspunkt nehmen ...
Wie Casaubon könnte man sich in Marburg mit der richtigen Sinnesschärfung auf konspiratorische Spurensuche begeben und fände an einem Abend den Plan, die Pforten mit Symbolen - man achte auf das Lothringische Doppelkreuz der Tempelritter - den obligatorischen esoterischen Buchladen (das Motiv bearbeitet Umberto Eco im Kapitel des in Paris umherirrenden Casaubon) und die Rittergasse ...
Fotos: (c) Stefan Scheffler
Wenn ich die Phantasie hätte, weiterzuspinnen, würde ich im Templerrathaus Linden landen mit den tiefen Kellern in der dicken Mauer vor der einstigen Kirche, der die Tradition der Templer bescheinigt wird, oder ich würde das in Wurfweite alte romanische Relief der Lindener Kirche, auf der auch der oben erwähnte Bonifatius zu sehen ist, mit dem Kirchenportal in St. André verbinden oder schauen, ob wenigstens die Freimaurer in der Nähe noch einen Unterschlupf in Gießen gefunden haben. Nach den Templern in Marburg würde ich nicht suchen, der Link auf das Ordenshaus ermangelt eines Impressums.
Fotos: Drittes Foto von links: Das Portal in St. André ist vom Author Palauenc05: Saint andre portal (CC BY-SA 4.0), nach Homberg war ich in Linden und Gießen selbst - (c) Stefan Scheffler.
Schnipsel 203: Joseph Conrad: The Secret Sharer

Foto: Alexey Komarov: Gulf of Thailand, May, 2018 (CC BY-SA 4.0).
Joseph Conrad ist der Schriftsteller britischer Seefahrt, dabei ist er der Schriftsteller der besonderen Begegnung, des Erlebnisses im Zusammentreffen des an sein Ich gewöhnten Menschen mit der sehnsuchtsfernen Exotik. Die Orte verändern sich, tropische Regionen werden zu Begegnungsstätten mit den entlegensten Bereichen des eigenen Ichs, die sich in ihrer übertragbaren Bedeutung schon im Titel manifestieren wie zum Beispiel in "Heart of Darkness", 1899.
In seiner Erzählung "The Secret Sharer", dessen deutsche Übersetzung nicht den ganzen Gehalt des Titels überträgt mit den Worten "Der geheime Teilhaber", bearbeitet Conrad das doppelganger-Motiv in sehr subtiler Weise. Meister der subtilsten Hinweise auf die englischsprachige Literatur war unser Dozent David W. Debney (vgl. 101). In meinen Randnotizen einer alten Seminarkopie meine ich seine Worte konserviert zu finden: Eine Geschichte, die die Sehnsucht thematisiere, dem eigenen Spiegelbild zu begegnen, einer Person mit dem gesamten Wissen über das eigene Wesen "... a hope to find someone of complete understanding and share one's own beliefs and attitudes ...", wow!
Die Bucht von Siam im Mündungsgebiet des Mea Nam liegt zu Beginn der Erzählung in absoluter, windstiller Reglosigkeit. An nur wenigen Bezugspunkten der Umgebung, einem Pagodentempel, senkrechten Stangen aus dem Wasser, die verwaiste Fischgründe markieren, findet das Auge einen Halt, sonst liegt seelenleer eine spiegelglatte Meeresoberfläche vor dem Betrachter. Sehen konnte ich dieses erzählerische Setting, auch spüren, die Worte Debneys wären mir dazu nicht parat gewesen: Der Erzähler, ein junger Kapitän auf seiner ersten Mission als verantwortlicher Schiffsführer, ist völlig allein, isoliert in seiner Rolle auf dem Schiff, abandoned - vielleicht im Sinne von "verlassen" in dieser völlig unbeweglichen, stillen Umgebung: "a gentle, calm, barren surrounding, lifeless ... thereby hostile in its peacefulness" ... eine erstarrte Landschaft "feindselig in ihrer Friedlichkeit", die Übersetzung trifft es wieder nicht.
Der namenlose Kapitän schildert (in der Übersetzung von Maria von Schweinitz und Richard Frenzl) seine Situation vor Beginn der Reise an Bord so:
" ... ich war der einzige Fremde in der Besatzung. Ich erwähnte das hier, weil es für das folgende Geschehen von einer gewissen Bedeutung ist. Doch was ich am stärksten empfand, war, dass ich auch dem Schiff gegenüber ein Fremder war. Und wenn ich die volle Wahrheit sagen soll: Ich war mir selbst irgendwie fremd" ... "somewhat a stranger to myself" ... (im Original).
Als Punkt in der Ferne ist ein weiteres Schiff im Sund auszumachen, die Sephora. Dem Bootsnamen konnte ich noch nicht seinen verborgenen Sinn entlocken, doch von diesem Segler schwimmt Leggat schutzlos unbekleidet, nur mit einem Moment des Ausruhens auf einer kleinen Erhebung im Meer ausdauernd und zielsicher auf das Boot des Erzählers zu und liefert sich in der Nacht seinem Schicksal aus. Er schlüpft vor den Augen des Kapitäns aus den dunklen Wassern des Ozeans an Bord und zeigt sich ihm als optisches Spiegelbild von Alter und Statur. Er offenbart sein Geheimnis, geflohen als inhaftierter Steuermann, der sich eines Totschlags schuldig gemacht hat in einer Sturmnacht, als es sein eigenes Schiff zu retten galt. Der nicht ausgeführte Schlag gegen einen Menschen in seinem Ungehorsam hätte die Besatzung der Sephora gefährdet - wenn auch mit moralischer Legitimation steht Leggat als Mörder vor dem Erzähler, zu dem sich sofort eine "geheimnisvolle Verbindung" herstellt: "Es war mir, als stünde ich meinem eigenen Bild gegenüber, das in der Tiefe eines riesigen trüben Spiegels zu sehen war."
Zwischen den beiden Männern entsteht ein unausgesprochener Pakt, der junge Kapitän geht die Gefahr ein, seinen Doppelgänger an Bord zu verbergen. Beide sind füreinander Teilhaber des nötigen Stillschweigens. Eine unglaublich intensive, vibrierende Konstellation, die Joseph Conrad vor dem Hintergrund einer ansonsten absoluten stillen See ersinnt. Zur Rettung der Freiheit des einen muss der andere in seiner aktiven Rolle als Kapitän die Grenzen seiner Handlungsmöglichkeiten ausloten, er entscheidet sich zum Entsetzen seiner Mannschaft zu einem äußerst gewagten Seemanöver, deren Hintergründe diese nicht durchschauen kann. Wind kommt auf, wird stärker. Knapp lenkt er sein Schiff an der Landmasse einer Inselgruppe vorbei, sodass die größte Nähe gewährleistet ist, die Leggat das Verlassen des Bootes und das Erreichen eines ungewissen, aber selbstbestimmten Lebens ermöglicht, und dem Schiff genügend ablandigen Wind des Abends in die Segel weht, um die Bucht zu verlassen und die Reise aufs offene Meer anzutreten. Das Eingehen auf seine durch Leggat personifizierte dunkle Seite seiner Existenz lässt ihn nicht nur zum meisterlichen Steuermann eines Segelschiffs heranreifen, er gewinnt dadurch Autonomie.
Eines meiner literarischen Ohrwürmer stammt unaustilgbar aus T.S. Eliots Gedicht "The Wasteland": "The boat responded. Gaily, to the expert with sail and oar." Es ist schon fast mysteriös zu nennen, dass ich in meiner neu angeschafften Übersetzung des "Secret Sharer" eine weitere Erzählung von Conrad finde: "Jugend"; in ihr die Worte: "... das trügerische Gefühl, das uns zu Freuden, zu Gefahren, in die Liebe lockt, in unsinnige Kämpfe - in den Tod; das jubelnde Bewusstsein der Stärke, die Leidenschaft des blühenden Lebens in einer Handvoll Staub ...", a handful of dust, das aber ist, wie gesagt, eine andere Geschichte.
Fotos v.l.n.r.: Joseph Conrad fotografiert von George Charles Beresford 1904 (auf Wikimedia Commons, public domain); Alexey Komarov: Sunset over Gulf of Thailand, 8 May 2018 (CC BY-SA 4.0); Welcome Images: John Thomson, River Menam, Siam (Thailand). Wellcome L0055723, (full credit line: This file comes from Wellcome Images, a website operated by Wellcome Trust, a global charitable foundation based in the United Kingdom. Refer to Wellcome blog post) neuer Zuschnitt (CC BY 4.0).
Schnipsel 204: Das Mysterium, sich selbst zu begegnen ...

(c) Stefan Scheffler, Kostbarkeiten unterschiedlicher Fokussierungsschärfe in Den Haag ...
In einer alten Ausgabe der Werke von Novalis finde ich einen Aphorismus in den Blütenstaubfragmenten, der an dieser Stelle gar nicht stehen dürfte, glaube ich: "Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, daß wir träumen." Darunter dann erst der Text, nach dem ich gesucht habe:
Die Phantasie setzt die künftige Welt entweder in die Höhe, oder in die Tiefe, oder in der Metempsychose, zu uns. Wir träumen von Reisen durch das Weltall; ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. Nach Innen geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und Zukunft …
Ich bin für das Motiv sensibilisiert, wenn sich Menschen an glatten Oberflächen selbst begegnen, wenn nach einer Durchbrechung der spiegelglatten Oberfläche eine verborgene Tiefe lauert. Eine Variante liefert uns Joseph Conrad in der Erzählung "The Secret Sharer" mit Leggat, der im Schutz der Nacht aus dem unbewegten Ozean heraus vor sein dort wartendes Pendant tritt. Eine symbiotische Begegnung zur Reife und Freiheit beider.
Über das Blütenstaubfragment von Novalis gelangt man schnell zur Suche der Mystiker, die in der Meditation oder Introspektion eine neue Güte der Selbst- oder Gotteserkenntnis ergründen. Der Bogen lässt sich weit spannen bis hin zu Sigmund Freuds Anbohren des Unbewussten, dem Versuch, die inneren Trennlinien und Eispanzer aufzubrechen, um sich am Ende in seinem ganzen Selbst zu begegnen. Im "Atlas eines ängstlichen Mannes" begibt sich Christoph Ransmayr auf Weltreise. Die tatsächlich gemachten Exkursionen an alle Enden des Erdballs werden nicht an den großen Orten an sich festgemacht, es handelt sich nicht um einen literarischen Reiseführer. Ransmayr schildert Episoden, die sich an den Enden der Welt zwar ereigneten, aber mit ihm als Reisenden etwas anstellten, es ist ein innerer Atlas eines Weitgereisten, der die inneren Spuren oder Narben der Begegnungen mit sich und der Welt dokumentiert. Jede Begegnung kann herausgegriffen werden, um zu zeigen: "Schau, das machte mit mir jener Ort." Und nicht der Ort an sich ist entscheidend, sondern, ob der Ort eine Symbiose mit dem Autor eingehen konnte, um bei ihm Spuren zu hinterlassen. Diese Art des Reisens unterscheidet sich von der Idee einer Fotosafari oder einer Tour des "Zeitausnutzens". Sie braucht freies Terrain auf der Seele, das für alle Eindrücke so offen ist, gegebenenfalls auch trotz der Größe des bereisten Ortes diesen als belanglos und nicht schildernswert kategorisieren zu können, um wiederum für andere Begegnungen oder Erfahrungen so offen sein zu können, dass die Kraft der Begegnung tatsächlich auf dem suchenden, vielleicht auch literarischen Radar Alarm schlägt. Christoph Ransmayrs Episode "Der Pianist" spielt in Yokohama, Japan. Er ist auf dem Rückweg der Besichtigung der Sankei-Gärten. Ein Ort, der eine Veränderung in der Begegnung mit der Zen-Kultur auslösen könnte. Es ist aber nicht dieser Ort, der den Moment zum Erlebnis werden lässt bzw. ins Zentrum der Schilderung gerät. Vielleich war er nötig, um die Sinne zu schärfen. Der Moment ergibt sich in der Näherung der Spiegelglatten Oberfläche des Hoteleingangs: „Ich erreichte mein Spiegelbild, öffnete die Glastür und betrat die Hotelhalle.“ Die Begegnung mit dem kleinen Pianisten löst ein Spiel der Perspektiven aus, die eine große Schnittmenge hat mit der Begegnung von Jim Knopf und Lukas mit dem Scheinriesen Herrn TurTur (vgl. dazu Schnipsel 45). Das Thema der Episode hat viel mit den Metamorphosen Ovids zu tun, dem Thema der Verwandlung, erspürt von Ransmayr in der unglaublichen Entwicklung von lange lange in der Erde eingegrabenen Larven der Singzikaden, die im Vergleich zu ihrer fast ewigen Dauer des Wartens nur einen Bruchteil an Lebenszeit im Überfluss eines kurzen Existenzzaubers an der Oberfläche haben, wo sie dann oft zu Abertausenden zertreten werden. Vielleicht ist es konstruiert, aber mein Leseradar galt der Sekunde des Wahrnehmens der Spiegelung in der glatten zu durchbrechenden Hotelfassade. Es ist ein Zen-Moment der gelebten Gegenwärtigkeit. Ein Meister, der die Meditation des Zen westlichen Suchenden vermittelt, ist Jack Kornfield, und er gehört vielleicht nicht hierher auf die Seiten eines nie abgeschlossenen Germanistikstudiums, trotzdem möchte ich ihn mit der Idee erwähnen, die ich sehr bewundere, sie drückt den Wesenskern des Yoga aus: "Denn mit der Aufmerksamkeit ganz im gegenwärtigen Augenblick zu sein, ist im Grunde genommen das Einzige, das Sinn macht, und wenn wir ihn verstreichen lassen, wird er für immer verloren sein."
Kornfields beschreibt in der Folge ein Zulassen von allen Eindrücken in der Meditation, erst dieses Zulassen allen Ballastes ermöglicht, ihn in seiner Schwere auch hinter sich lassen zu können. Japanische Gärten können vielleicht helfen, den Seinszustand von Großstadtreisenden so zu verfeinern, dass sie ihr Ich im glattgeschliffenen Material jenseits der reinen optischen Sensation wahrnehmen können.
Die optische Reflektion des Spiegels hat akustisch ihre Entsprechung im Schall des Echos. Echo, die Sagengestalt Ovids, ist mit dem Fluch belegt, nur das über ihre Lippen zu bringen, was ihr zuvor der Schall eingehaucht hat. Auch hier gibt es - allerdings eine sehr tragische - symbiotische Konstellation, denn in ihrer Liebe trifft Echo auf den auf allen Kanälen der Zuneigung und Mitmenschlichkeit blinden und abgeschotteten Narziss. Angehimmelt von allen, findet er sich berauscht am eigenen Spiegelbild. Unerreichbar von außen verliert er sich in sich selbst. Die zerstörerische Kraft der Selbstverliebtheit ist ein Abweg, dessen Gefahr damit zu tun hat, an der oberflächlichen optischen Sensation hängen zu bleiben.
Zu "Through the Looking Glass", also "Alice im Wunderland" im deutschen Titel, kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich kenne aber die Kurzgeschichte "Im Spiegel" von Margret Steenfatt, in der ein Junge durch viel Schminke und Farbe, die er seinem Spiegelbild aufkleistert, jedes falsche Bild von sich überwindet und zu seinen Leuten nach draußen geht, nachdem er das Bild mit am Ende blutiger Faust zerschlagen hat. Er geht mit dem Gesicht und Wesen, das seins ist.
In der Bearbeitung von John William Waterhouse ist erstaunlich, wen das Spiegelbild anschaut ...

John William Waterhouse: Echo and Narcissus ... iste ego sum (auf Wikimedia Commons, public domain).
Fotos obere Reihe v.l.n.r.: R.L.Huffstutter: Sankien Gardens, Yokohama 1961 by R.L.Huffstutter, neuer Zuschnitt (CC BY 2.0); Joe deSousa: Sankei-en Gardens Yokohama, neuer Zuschnitt (cc-Lizenz 1.0); Pete Souza: Barack Obama in a hotel in Yokohama (auf Wikimedia Commons, public domain); Fotos untere Reihe: (c) Stefan Scheffler
Schnipsel 205: Das Geheimnis des Grufthauses
Ein geheimnisvoller Ort: Der alte Friedhof Gießen, (c) Stefan Scheffler

Foto: Highgate Cemetery, London: HeritageDaily, Highgate Cemetery 10, leicht bearbeitet (CC BY-SA 4.0)
Es gibt Orte, die bereits ihre geheimnisvolle Ausstrahlung im Namen tragen und zum Grusel einladen, die Schattenburg in Feldkirch zum Beispiel, dort würde ich gerne mal ein Treffen mit Meistern der gothic novel einberufen … mein Text wird mich von Beginn an auf Abwege lotsen, die beiden Themen, um die es mir geht, haben die Neigung zur Flüchtigkeit.
Der Titel "Un lieu incertain" von Fred Vargas lautet in der Deutschen Übersetzung "Der verbotene Ort" - die makabere Eingangsszene spielt vor dem Londoner Friedhof Highgate, um den sich tatsächlich bis in unsere Gegenwart eine Menge dunkler Mythen ranken, ähnlich wie der Efeu um einige Gräber. Kommissar Adamsberg und Inspektor Danglard stehen vor dem Rätsel 17 ordentlich platzierter Schuhe, in denen zum Entsetzen noch 17 Füße stecken. Highgate ist ein Ort, der geradezu zum Schwelgen in düsteren Eindrücken einlädt, auch ohne einen prägnanten Namen wie Schattenburg … flüchtig mein Hinweis, dass in Highgate ganz ohne Mythos Karl Marx begraben liegt.
Nicht ganz Highgate, aber ein besonderer Ort mit vielen besonderen Geschichten und Geheimnissen ist der Alte Friedhof in Gießen. Er dient der Stadt als Erinnerungsstätte ebenso wie als grünes Refugium einer Parkanlage. Wenn das Licht gegen Abend schräg auf einige schwarze Granitkreuze trifft, fangen sie hier und dort an weiß zu leuchten, wenn man nur ein wenig die Perspektive bzw. die Blickrichtung ändert. Vielleicht könnte es in diesem Schnipsel um das berühmteste Grab des Friedhofs gehen und sein kleines Geheimnis. Wilhelm Conrad Röntgen wurde hier auf eigenen Wunsch im Familiengrab begraben, in dem bereits seine Frau und seine Eltern beigesetzt worden waren. Seine Eltern lebten eigentlich in Apeldorn in den Niederlanden, Röntgen verbrachte wichtige Jahre in Gießen, hatte dort seine erste gut bezahlte Professur. Warum das Familiengrab in Gießen liegt, warum seine Eltern dort begraben wurden, ich weiß es nicht. Conrad Wilhelm Röntgen selbst starb in Würzburg. Seine Entdeckung der alles durchdringenden Strahlen, die neue Einblicke in die bis dahin verborgensten Geheimnisse des Körperlichen ermöglichten, wurden mit der Auszeichnung des Nobelpreises gewürdigt. Unten sieht man eine Röntgenaufnahme seiner Labortür, ich mag es sehr, wenn Türen als Sinnbilder einer verschlossenen Wahrheit ins Spiel kommen, meistens gefällt mir dann das Wort Pforte oder Portal besser … auf dem berühmtesten Grab der Stadt ist der Vorname falsch geschrieben; solche kleine, seltsame und rätselhafte Details mag ich ebenfalls sehr.
Gleich in der Nähe der sehr alten Friedhofskapelle stehen zwei kleine Grufthäuschen, selbst mit der besten Digitaltechnik kann ich ihnen nicht die Inschriften der durch die Überdachung in Schutz genommenen Grabsteine entlocken, sie sind allzu stark unsichtbaren Einflüssen ausgesetzt, die ihren Zerfall bewirkten. In einem, dem größeren der beiden Grufthäuschen wurde Justus Sinold genannt Schütz (welch geheimnisvoller Name) begraben. Nach dreißig Jahren Krieg wurde er 1650 der erste Kanzler der neu gegründeten Universität Gießen. Die Grabstätte ist eigentlich die Familiengrabstätte mütterlicherseits, Vietor. Wenn man sich einmal an die Rückseite des kleinen Gebäudes begibt, das von vorne schon mit einem grimmigen Blick gesegnet ist, entdeckt man, dass der Maurer kurzerhand auf nicht mehr gebrauchte Grabsteine zurückgriff, um an Rückwand zu gewinnen, was mit kleinen Ziegeln etwas länger gedauert hätte. Ich wäre gerne Zeuge des Moments des Einmörtelns gewesen, so kann ich der Rückwand nur noch ein halbes ungelöstes Geheimnis entlocken, aber vielleicht ist auch irgendwo eine Lösung in alten Dokumenten niedergeschrieben. Dieser eingebaute Grabstein der Rückseite des Grufhäuschens traf mich deshalb so aus heiterem Himmel, weil mir mein Lieblingsmotiv der umgekehrten Ikonografie, hier des umgekehrten Kreuzes sofort in die Augen stach. In Schnipsel 192 habe ich die lange Reihe der Beispiele von der umgekehrten Kirch‘ bei Gryphius über Büchners auf dem Kopf laufenden Lenz und Petrus und den Medusenkopf und der Rache an Mussolini noch einmal aufgelistet, es waren bis dahin bestimmt ein Dutzend, inklusive der großen Bearbeitung des Motivs bei Umberto Eco "Im Namen der Rose" (vgl. 192). Bereits mit dem von Stefan Matlik gestalteten Buchcover von Ecos "Das Foucaultsche Pendel" war eigentlich mein neuer Eifer für die Motivsuche sensibilisiert (vgl. 202 oben), dann, wie gesagt, der Blick auf die kleine Rückwand … und hier die weiteren Motive, die mich auf unterschiedlichen flüchtigen Wegen geradezu überrannten:
Dennis Scheck kann ganz schön austeilen, auf einer Lesung gefiel mir das unsensible Attackieren um des Showeffekts Willen weniger, trotzdem ist sein Kanon der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur recht amüsant, gerade wenn zu Recht bereits an vierzehnter Stelle Donald Duck gewürdigt wird. In der von Scheck zitierten Episode "Die Wette" debütiert Gustav Ganz und er stelle als "widerliche[s] Schoßkinde[s] des Glücks alle Prinzipien der Leistungsgesellschaft auf den Kopf. Das tat bereits Robert Luis Stevensons kleine Geschichte "The Bottle Imp" (vgl. 166). Wie sehr im kapitalistischen System Profitorientierung und Täuschung der Realitätswahrnehmung im Zusammenhang stehen, zeigt auch auf wunderbare Weise die Panzerknacker Episode "Schöner Schein" aus dem Jahr 2017 von Jaakko Seppälä mit den Zeichnungen von Carmen Pérez und Tony Fernández, auf Deutsch übersetzt von Hartmut Kasper. Es ist nicht ganz das Motiv der 180-Grad-Drehung, aber irgendwie fällt mir Selma Lagerlöfs Nils Holgersson ein, dessen neuer Blick auf die Welt von ganz weit oben aus der Vogelperspektive und über die Assoziation gelange ich wieder zu Dennis Scheck, wenn er den fliegenden Karlsson auf dem Dach von Astrid Lindgren folgendermaßen charakterisiert: "Er ist ein Saboteur. Ein Anarchist. Ein Aufwiegler und Anstifter zu Unfug aller Art. Ihr Mächtigen der Welt: Zittert, solange noch ein Karlsson frei über euren Dächern herumfliegt!" Kein Mäandern mehr, auf zum Kopfstand in Reinform: Der bekanntestes Auf-den-Kopf-Steller ist sicherlich der Megastarmaler Georg Baselitz, auch so ein Profi der Provokation, über den ich aber nicht viel schreiben kann, weil ich mich nicht wirklich mit ihm auskenne bzw. mich nicht mit ihm beschäftigt habe. Kaum ein Schnipsel ohne eine Erinnerung an meinen Professor Alfons Glück, er schärfte unseren Blick für die umgekehrte Kirch‘ von Gryphius und er erzählte uns die Anekdote, mit der er die Intelligenz von Georg Lukács bekunden wollte, dieser habe Lesen gelernt, indem er seiner Schwester, es könnte auch ein älterer Bruder gewesen sein, gegenübersitzend bei den schriftlichen Hausaufgaben auf die Finger geschaut habe, er habe das Lesen über die umgekehrte Schrift gelernt. Ich weiß nicht, warum ich mir so etwas behalten habe.
In Dickens "Great Expectations" wird Pip vor Grabsteinen um die eigene Achse gewirbelt und hängt kopfüber nur an einem Bein festgehalten von Abel Magwich (vgl. 107), dies widerfährt auch Archie Ferguson in Paul Austers "4 3 2 1". Die Kindheitserinnerung von 1.1 beginnt mit der Schilderung von Fergusons Wahrnehmung der Gefahren des Lebens, dem Tod durch Ersticken an einem glitschigen Bonbon entkommt er nur, da ihn seine Mutter an beiden Füßen emporreißt und immer noch eine Hand frei hat, das Drops durch beherzte Schläge auf den Rücken einer immer noch freien Hand aus der Luftröhre zu befördern. Nur wenig später in der Episode aus einem anderen Leben Fergusons 2.3 heißt es, dass Ferguson nach dem Tod seines Vaters zu dem Schluss gekommen sei, "dass er in einem auf den Kopf gestellten Universum voller endlos umkehrbarer Behauptungen“ lebe.
Zwei flüchtige Schlussbemerkungen: Nicht umgekehrt in die Mauer eingelassen, aber ähnlich benutzt finden sich manchmal sogar auf Feldwegen einstmals trauernde Namensträger für eine Erinnerung wohl begrenzter Ewigkeit als Pflastermaterial für Feldwege, wie schade. Doch um dieser Idee die Schwere zu nehmen, sei mit Augenzwinkern auf Diana Ross hingewiesen, sie sang - das Motiv des umgedrehten Jungens quasi umkehrend - "upside down, boy you turn me", das Lied mochte ich aber nie so wirklich, eben nur ein Anflug einer Erinnerung.
Fotos obere Reihe v.l.n.r.: (c) Stefan Scheffler, alter Friedhof Gießen.
Fotos mittlere Reihe v.l.n.r.: Justus Sinold (auf Wikimedia Commons, public domain); die Schattenburg, Feldkirch (c) Stefan Scheffler; ein Feldweg bei Muschenheim (c) Stefan Scheffler; Wilhelm Conrad Röntgen (auf Wikimedia Commons, public domain).
Fotos untere Reihe v.l.n.r.: Georg Lukács mit Anna Seghers: Bundesarchiv, Bild 183-15304-0097 / Sturm, Horst: Berlin, Tagung Weltfriedensrat, Georg Lukacz, Anna Seghers (CC BY-SA 3.0 DE); Röntgens Labortür geröntgt: The door of Röntgen's laboratory, with a platinum plate atta Wellcome V0029522 (full credit line: This file comes from Wellcome Images, a website operated by Wellcome Trust, a global charitable foundation based in the United Kingdom. Refer to Wellcome blog post (CC BY 4.0); Röntgens Grab in Gießen, (c) Stefan Scheffler, Georg Baselitz fotografiert von Lothar Wolleh: Georg Baselitz by Lothar Wolleh (CC BY-SA 3.0).
Schnipsel 206: Verschlüsselungen
(c) Stefan Scheffler: Normandie, die Erinnerung an den Besuch dieses Strandabschnittes durchfährt mich noch heute mit Schrecken, selbst die gemachten Fotos hatte ich verdrängt, war mir sicher, dort nicht die Kamera in die Hand genommen zu haben. Die Gespräche mit einem jüngeren Menschen im Restaurant am Abend klärten viele meiner Bedenken zu diesem Teil einer Reise ...
Mein Freund Jean-Pierre las vor einiger Zeit Oskar Maria Graf. Ich habe diesen bayerischen Autor noch nicht gelesen, aber ich kenne jetzt eine wichtige Anekdote zu ihm, danke Andreas. Voller Empörung muss er wohl zur Kenntnis genommen haben, dass die Nazis ihn nicht in der Brandnacht auf den Scheiterhaufen brennender Autoren geworfen hatten. Er forderte sie auf: Bitte verbrennt mich auch. Wie soll man das in Worte fassen? Er nahm nie für sich in Anspruch, zu den erfolgreichsten und besten Literaten zu gehören, immer wieder findet sich der Hinweis, dass er sich selbst als Provinzschriftsteller sah ... 1933 wollte er aber nicht übersehen werden, er wollte nicht durchgehen lassen, dass seine Stimme von den falschen vereinnahmt wurde, er der ganz klar Position bezog gegen die zerstörerische Diktatur, die in Deutschland Raum greifen konnte, und bereits zuvor als Pazifist und Kriegsgegner 1914. Hierzu findet sich eine sehr sehenswerte Passage in Klaus Ickerts Dokumentation (die allerdings auch große Schwächen hat, wenn sie warum auch immer voyeuristische Details geschwätzig in den Blick rückt, die völlig ohne Belang sind). Es lohnt, wenn man den Bericht ab der achten Minute mal für drei, vier Minuten laufen lässt. Man vermutet nicht, wie konsequent man zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen Krieg und Diktatur kämpfen konnte. https://www.br.de/mediathek/video/lido-oskar-maria-graf-dahoam-in-amerika-av:5a3c44b700b072001ccf321d
Der Kampf gegen den Faschismus wurde nicht nur durch den inneren Widerstand Europas gewonnen, er wurde durch die Zentrierung der Kampfkraft vieler Verbündeter gewonnen. Als die USA ihre Truppen formierte und am 6. Juni in der Normandie anlanden wollte, musste die französische Résistance in Kenntnis gesetzt werden. Zuvor war das große kryptische System der Nazis Enigma geknackt worden. Ein Beitrag derjenigen, die sich auf die Fähigkeit verstanden, als Meister der Kommunikation, Mathematik und Technik Sprache in ihrer kompliziertesten Verschlüsselung zu dechiffrieren. Die Rettung der Welt hatte damals wenigstens in einer kleinen Schnittmenge schließlich mit Lyrik zu tun, auch hierauf wies mich Jean-Pierre Letourneur hin.
Am fünften Juni 1944 übertrug die BBC ein Gedicht …
(c) Jean-Pierre Letourneur, danke für die Genehmigung der Ablichtung deiner Seiten an diesem Ort (ohne Ausrufezeichen).
Oskar Maria Graf lese ich gerade, sein Roman "Der Abgrund" zeichnet in einer erschreckenden Klarheit die Geschehnisse nach, die zum Faschismus in Deutschland führten. Unglaublich, dass ich diesem Schriftsteller noch nicht begegnet war. Verlaine, die französische Lyrik, werde ich mir wohl für ein Studium eines zukünftigen Lebens aufheben. Die Lebensläufe von Verlaine und Rimbaud überschneiden sich in Exzessen. Ich kenne mich zu wenig aus, lese mich nur flüchtig ein. Beide waren wohl Sympathisanten, vielleicht Teilnehmer der Pariser Commune 1871. Nicht weit entfernt wo sich die Karl-Marx-Allee und die Straße der Pariser Kommune kreuzen, steht eine kleine Villa, heute ein Museum. Dort kann man, ohne Eintritt bezahlen zu müssen, den großen Tisch sehen, an dem die Kapitulation Deutschlands unterzeichnet wurde, ein Friede seinen Anfang nahm, in dem ich seit meiner Geburt lebe.
Die zweite Strophe sei wohl das Signal gewesen: Et blême, quand / Sonne l’heure …
Ein weiter Bogen, Paul Verlaine ca. zur der Zeit, als er sein Herbstgedicht schrieb, die Chiffrier- und Dechiffriertechnik der Enigma-Maschine, Oskar Maria Graf, ein Zeitungsausschnitt und in einem Interview. (Nur als kleiner Hinweis: Der Saal, in dem Graf las, hieß "Zum Auge Gottes".)
Fotos: V.l.n.r.: Frédéric Bazille "Paul Verlaine" (auf Wikimedia Commons, public domain); Nattnewl: Enigma and decoder at Discovery Park of America (CC BY-SA 4.0); Plakat in Wien "Verbrennt mich!" (auf Wikimedia Commons, public domain); Rosty: Oskar Maria Graf und Gottlieb Branz1958 (CC BY-SA 4.0) - 1958 war das Jahr, in dem Graf das erste Mal wieder Deutschland besuchte, erst nachdem er amerikanische Staatsbürgerschaft geworden war ...
(c) Stefan Scheffler: eine Straßenkreuzung in Berlin, wenn man genau danach sucht, ein Friedenszeichen unserer Zeit, der Tisch, an dem die Kapitulation Deutschlands unterzeichnet wurde im Deutsch-Russischen Museum, Berlin.
Schnipsel 207: Isola Segreta

(c) Stefan Scheffler
Lüften wir das vielleicht letzte Geheimnis! In 202 hatte ich es bereits beinahe ausgeplaudert. Das letzte Geheimnis ist leer, an dieser Stelle wollte ich es damals nicht verraten. Jetzt fällt es mir leicht, denn das letzte Geheimnis ist … dazu am Ende mehr.
In den vergangenen Texten gab es Hinweise auf Kuba, Elba oder Zypern. Es wäre ein großes Unterfangen, wollte man sich der literarischen Bearbeitung des Motivs der Insel widmen. Manch Titel ist dabei vielversprechender als der Lesestart, deshalb habe ich einige Bücher noch einmal zur Seite gelegt wie D.H. Lawrence‘ "The Man who Loved Islands". Den Titel von Konsalik "Niemand ist eine Insel" fand ich gut, Konsalik habe ich aber tatsächlich noch nicht gelesen.
Dieser Zehnerblock widmet sich der Thematik des Verborgenen, des Rätsels und Geheimen. Scheinbar doppelt und dreifach hermetisch abgeriegelt scheint die Literatur Franz Kafkas uns einen einfachen Zugang zu verwehren. In irgendeinem Text habe ich eine Idee dazu fälschlicherweise Walter Benjamin zugeschrieben, die Idee, auf die ich mich beziehe findet sich aber bei Walter Muschg:
Er [Kafka] umrätselt wieder die tiefste Frage, die der menschlichen Existenz. […] Das Rätsel des Menschseins ist für ihn unlösbar, und es gibt für ihn keine Instanz, an die er sich um Auskunft wenden kann. Er ist ein Rätseldichter, der die Lösung selbst nicht zu kennen scheint. Oft - aber nicht immer - ist sie ihm tatsächlich verborgen, wenn er nämlich Rätselbilder schafft, die aus dem Unbewussten, dem Traum auf ihn eindringen oder wenn er sie in der "Inspiration" empfängt. Diese Bilder schwimmen dann wie Eisstücke auf der Oberfläche seines künstlerischen Bewusstseins, und die Echtheit seines Bilddenkens - Doppelsinn von manifestem Bild und latenter Bedeutung - tritt am zwingendsten hervor. (Walter Muschg: "Der unbekannte Kafka")
Und mit einer Insel bei Kafka, möchte ich den Reigen beginnen. Eine seiner bekanntesten Parabeln "In der Strafkolonie" führt einen Reisenden auf eine entlegene Insel. Ich bin mir unschlüssig, ob William Goldings "Lord of the Flies" in dieser Reihe passt und entscheide mich dagegen. Ithaka passt bedingt, Irland über James Joyce’s "Ulysses" unbedingt. Über Irland gelangen wir mit dem Iren Jonathan Swift über "Gulliver’s Travels" nach Laputa und Lilliput, das im Deutschen seltsamerweise ein "l" verliert. Zurück blicken wir kurz auf die kollektive Erinnerung an Atlantis und die utopische Vision davon in Thomas Morus‘ "Utopia", um Segel zu setzen, ihnen eine Angriffsfläche für zielsichere Winde zu liefern, auf der Reise hin zum Inbegriff einer geheimnisumwitterten Insel: Robert Louis Stevensons: "Treasure Island" - der Schatzinsel schlechthin. Mit schlechtem Wind im Segel landete schiffbrüchig Alexander Selkirk auf der Isla Más a Tierra am Ende der Welt neben Chile, um mit dem Namen Robinson Crusoe über den kleinen Umweg eines Romans von Daniel Defoe für immer unvergesslich zu werden, selbst wenn in den 1990er Jahren die Regierung nicht beschlossen hätte, den Namen der Insel in Robinson-Crusoe-Insel umzubenennen, was wiederum einen Federstrich im "Atlas eines ängstlichen Mannes" von Christoph Ransmayr bewirkte. Mein Lieblingskommissar von Fred Vargas, Jean-Baptiste Adamsberg, landet natürlich in der sagenumwitterten Gegend Islands und meine Tochter las Cornelia Funkes Jugendroman "Herr der Diebe", um den es hier leider überhaupt nicht geht. Nur die dort vorgefundenen "locations" der Sacca della Misericordia und der Isola Segreta seien hier erwähnt, weil diese meine Tochter in ihrer wunderschönen Geschichte "Isola Segreta" mit dem letzten Geheimnis versah.
Die Vorhänge der vielen Fenster waren rosarot, und auf dem Dach stand eine Statue von einem goldenen Löwen mit Flügeln, auf dessen Rücken ein Specht saß. Die riesige Tür war mit wunderschönen Schnitzereien verziert, und auf dem Türknauf saß eine kleine vergoldete Elfe. Wenn man genau hinsah, konnte man an der weißen Fassade Muster erkennen, die mit hellblauer Farbe gemalt waren …
Eine Mutter und ihre Tochter verlieren hier die Sehkraft ihrer Augen. Ich habe meine Tochter gefragt, was das Geheimnis ihrer Isola Segreta sein wird, sie weiß es noch nicht. Wir befinden uns in Karl Poppers Welt III (vgl. Schnipsel 91). Einer Welt, die ihr Geheimnis noch ohne Verbindung zur denkenden Materie bewahrt, und damit die Leere des letzten Geheimnisses bei Umberto Eco toppt. Vielleicht werden wir irgendwann verstehen, wie aus elektrischen Nervenströmen Gedanken entstehen, aus Materie das, was wir als Ideen oder Gedanken wahrnehmen in unserer Reise mit ca. einer Million Kilometern pro Stunde um einen flüchtigen Gasball. Es bleibt nicht mehr viel Luft für die aller letzten Geheimnisse oder ein aller aller letztes …
Fotos v.l.n.r.: Godrey Kneller malte Daniel Defoe (Royal Museum Greenwich); eine Illustration zu "Robinson Crusoe", die berühmte Fußabdruck-Szene, von Walter Paget; eine Illustration zu Thomas Morus "Utopia"; Benjamin Mottes Illustration der fliegenden Insel Laputa und Karte von Lilliput und schließlich Jonathan Swift gemalt von Charles Jervas (National Portrait Gallery) - (alle auf Wikimedia Commons, public domain).

Foto: Die Robinson-Crusoe-Insel, Serpentus: Isla Juan Fernandez (vista hacia Robinson Crusoe desde Montaña), (CC BY-SA 3.0), als Alexander Selkirk hier strandete hieß die Insel des Juan Fernandez Archipels (Chile) noch Isla Más a Tierra (Insel näher am Land).
Schnipsel 208: Tap. Tap.
Fotos: V.l.n.r.: Sinus, Cosinus und Tangens im Einheitskreis von Ichijiku: Trigonometric functions unitcircle firstphase, weißer Hintergrund neu (CC BY-SA 3.0); Blickfeld nach Hans Goldmann mit blindem Fleck von Pignol23: Goldmann visual field record sheet (CC BY 3.0).
Von den begreifbaren Geheimnissen unserer Welt werden mir leider einige für wohl immer verborgen bleiben. Aber selbst dort, wo mein Geist aufhört zu funktionieren, kann ein Funke der Begeisterung überspringen. Sehr begeisterte mich zum Beispiel der Hinweis, dass der Tangens, anders als seine Verbündeten Cosinus und Sinus, Definitionslücken hat. Die Definitionslücken des Tangens, wie sympathisch. An einer Stelle ist unser Auge unfähig, optische Reize aufzunehmen, da der Sehnerv Platz braucht, die Datenübertragung auf den Weg zu bringen. Für diese wichtige Aufgabe wird eine Wahrnehmungslücke in Kauf genommen und kurzerhand mit der Fähigkeit der mutigen Ergänzungsdeutung kompensiert.
Sich dem Thema der Blindheit zu nähern, bedeutet, dass man sich darüber im Klaren sein muss, über eine für die Betroffenen tragische Einschränkung zu schreiben, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. In den letzten gut 200 kleinen Eintragungen dieser Seiten kommt - zumeist im übertragenen Sinn - das Wort "blind" oder Blindheit ein Dutzend Mal vor z.B. in 54 "Vom Hinsehen" oder 140 in der Erwähnung H.G. Wells "Country of the Blind"; nur einmal findet sich der Hinweis auf eine Taubheit. Dies könnte darauf hindeuten, wie wichtig in der Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Wesen der Sehapparat ist, wie oft er in der metaphorischen Tragweite eine Bearbeitung erfuhr. Klaus Mann schildert zu jedem Charakter seines Werks "Mephisto" das Aussehen oder die Wirkung der Augen. Ernst Toller und Ernst Weiß widmen sich der kurzzeitigen nervösen Erblindung Hitlers, auf den Roman von Ernst Weiss "Der Augenzeuge" habe ich in 54 hingewiesen. Bei Umberto Eco zeigt sich die Verblendung des Greises Jorge in seinem Leiden, die Sehkraft eingebüßt zu haben. August von Platen dichtet in seinem Gedicht Tristan: "Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, / Ist dem Tode schon anheimgegeben." Dinge nicht anschauen zu dürfen, ein Verbot in den Weg gestellt zu bekommen, findet in der Strafe der Versteinerung Eurydikes bei Ovid eine Bearbeitung. Orpheus, der Sänger, ist nicht mehr zu trösten, nachdem sein sorgenvoller Blick zurück doch nur die endgültige Verabschiedung von seiner Geliebten Eurydike bewirkt hat. Rilkes Panther kann noch Bilder erfassen:
Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille
sich lautlos auf -. Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder angespannte Stille -
und hört im Herzen auf zu sein.
... die Fähigkeit ist abgestumpft, betäubt, geopfert, am Ende nutzlos geworden.
Ein fast letztes Mal der Verweis auf Ovid. Tiresisas ist mit dem Verlust der Sehfähigkeit bestraft worden, nachdem der Wandler zwischen den Geschlechtern das Lustempfinden der Frauen ungleich höher bewertet hat. Die Beantwortung der an ihn gestellten Frage lässt ihn in Ungnade fallen, Heras Strafe nimmt ihm das Augenlicht ... und er wird zum Seher, da die Ungerechtigkeit des Urteils Kompensation einfordert, die ihm die Götter gewähren. Der mächtigste Blick in die Zukunft wird demjenigen zugesprochen, der sich jenseits der rezeptorischen Weltaufnahme befindet. In der Moderne bedient sich T.S. Eliot dieses Sehers Tiresias als Geleit durch sein kryptisch verschlüsseltes Gedicht "The Wasteland".
Ich mag mir nicht vorstellen, welche Reaktionsbeschleuniger dazu geführt haben, dass James Joyces Augenlicht - immer in heikler Gesundheit befindlich - ans Limit kam. Es finden sich Hinweise, dass er seinen Stock, der zum dekorativen Attribut seiner Statuen z.B.in Dublin wurde, eine ganz andere Rolle in der Sinnesverarbeitung gespielt haben könnte. Im größten Versuch, den Lesern nicht nur ein literarisches Geheimnis als Herausforderung zu offerieren, sondern ihnen auch verschiedenste Hinweise auf eine mögliche Entschlüsselung an die Hand zu geben, kommt ein junger Piano-Stimmer vor, der unklugerweise auch noch seine Stimmgabel vergessen hat ... hier und dort taucht er auf im Gewirr der Sinneseindrücke neben scheppernden Bettfedern, Fürzen und schlagenden Türen ... "Tap. Tap.Tap." Es ist das Geräusch des Blindenstocks ...
Seine Gabe des Klavierspiels - er ist nicht nur ein Stimmer der stumpfen Töne - findet in den Charakteren des Romans größte Zustimmung. Die Tragik reduziert Joyce auf das Wesentliche, die Tragweite kann man in den nicht geschriebenen Worten versuchen zu ergründen, in den Lücken oder ausgeblendeten, aber nicht stummen Bereichen. So wie Stephen Dedalus zu Beginn des Buches am Sandymount Beach ausprobiert, wie er mit seinem Stock (ashplant) sich als Blinder zurechtfinden müsste.






Fotos: V.l.n.r.: Erstausgabe von Ulysses aus dem Jahr 1922 von: The Little Museum of Dublin: Ulysses by James Joyce - first edition, 1922 (CC BY-SA 4.0); James Joyce fotografiert von Conrad Ruf; Tyne & Wear Archives & Museum: Das Sunderland Museum und die Sunderland Blindenschule bot Kurse und Vorlesungen an, damit Blinde die Welt über das Greifen wahrnehmen konnten, 1913; eine Havard-Veranstaltung 1947 (das Foto habe ich bereits an anderer Stelle benutzt) mit T.S. Eliot in unterer Reihe als Zweiter von rechts; Henry Singletons Bearbeitung des Tiresias Motivs, zu sehen in der National Tate Gallery; Auguste Rodins Bearbeitung des Orpheus und Eurydike Motivs, zu sehen im Museum of Modern Art, New York (alle auf Wikimedia Commons, public domain).
Schnipsel 209: O... ungelöst
(c) Stefan Scheffler
Im letzten Schnipsel dieses Blocks wird es um das Schild des A. gehen, hier geht es noch einmal um das Rätsel des O.s. Wie einfach mögen die Zeiten gewesen sein, als zwischen diesen beiden Buchstaben das gesamte Wissen der Welt passte. Das Wissen war immer ein wahres mit der Gewissheit dessen, was das A & O sei. Variationen der Wahrheit waren aber nicht ausgeschlossen, sind sie bis heute nicht. Hier nur eine kleine Erinnerung, ein ungelöstes Problem: Wir wissen noch immer nicht, was das für ein Dings vom Dach ist, das wir in Schnipsel 77 mit Kafkas Odradek in Verbindung brachten ...
Schnipsel 210: Das Schild des A.

Ithaka, die Ankunft einer Reise. Das Bild ist von Jean Housen: 20140411 ionion pelagos028, neuer Zuschnitt, neu kontrastiert, retuschiert (CC BY-SA 3.0).
"Du gleichst dem Geist, den du begreifst!", wettert in etwa der heraufbeschworene Erdgeist gegenüber Faust. Goethe hatte bereits in seiner Ballade "Der Zauberlehrling" das Thema der Hybris bearbeitet. Manchmal ist es Zeit, eine Grenze zu ziehen, eine Reise zu beenden und vielleicht auch einzusehen, dass die Augen größer als der Appetit waren. Doch der Reihe nach.
Es soll der letzte Hinweis auf das Lesen Ovids werden, auf jene Metamorphosen, die mich doch sehr begeistert haben. Am Ende, kurz bevor der Dichter selbst die Szenerie verlässt, führt Ovid das große Streitgespräch zwischen Odysseus und Ajax vor großer Kulisse auf. Der Held Achilles fiel im Kampf um Troja und beide, Odysseus und Ajax erheben Anspruch darauf, die mächtigen Waffen, das Schwert und das Schild als würdige Erben an sich nehmen zu dürfen. Ajax scheint das Kraft-Potential zu haben, der Größe und Macht der Waffen nicht nur gewachsen zu sein, er kann sich auch gut verkaufen. Nach seiner Rede scheint kaum ein Zweifel möglich, dass er, der integre und loyale Kämpfer, als einziger als neuer Waffenführer, insbesondere des Schildes in Frage kommt. Der letzte Zweifel wird mit meisterlicher Rhetorik aus dem Weg geräumt, gelingt es Ajax doch, Odysseus zu schmähen: als Feigling, als Trickser, "verzagt wie immer". Zum ersten Mal sehe ich Joyces Leopold Bloom mit dem Odysseus Ovids in dieser Schmährede verschmelzen. Nachdem selbst der Stammbaum von Odysseus in Misskredit gebracht wurde - ich verneige mich vor Joyce neben Ovid einmal mehr - scheint keine Gegenrede des der Lächerlichkeit preisgegebenen Helden zweiter Klasse mehr möglich, die in der Lage wäre, eine Rehabilitation, ganz zu schweigen eine Inbesitznahme der Waffen bewirken zu können. Dann ergreift Odysseus trotz scheinbar aussichtsloser Lage das Wort, 2000 Jahre vor Hollywood. Seine Arme scheinen dünner, sein Ruf brüchiger, seine Weste fleckiger - aber sein Verstand bedient sich des Skalpells, nicht der Axt. Warum am Ende die Klugheit vor der Kraft zu stehen hat, muss man unbedingt selbst nachlesen. Das wichtigste und schönste Argument verrate ich als aller aller letztes Geheimnis an dieser Stelle trotzdem: Die Rüstung, um die es geht, ist ein "Werk höchster Vollendung", das ein "roher, gefühlloser Kriegsknecht" kaum zu tragen vermöge: "Er hat ja den Figurenschmuck des Schildes noch gar nicht zur Kenntnis genommen, den Ozean und die Erde und samt dem hohen Himmel die Sterne, die Plejaden, die Hyaden und den Großen Bären, der nie ins Meer sinkt". Dann der argumentative letzte Dolchstoß: Ihm, Ajax, fehle das Verständnis für die Rüstung, die er begehrt. Schach und matt. Ajax stürzt sich ins eigene Schwert und überlässt dem Meister der klugen, nicht heimtückischen List das Feld bzw. den wertvollen Waffenschmuck.
Pippi Langstrumpf war stark, gewonnen hat sie über die Prusseliesigkeit aber mit der Gewalt, mit der sie Astrid Lindgren zurecht zum Kampf ausgestattet hat: Aufsässigkeit, dem Gegenteil von Autoritätshörigkeit und Schläue. Mit diesen Eigenschaften lässt auch Leopold Bloom im an anderer Stelle thematisierten Giganten-Kapitel "Zyklopen" den Bürger stehen, dessen eines enge Auge, irritiert durch Blooms fuchtelnde (geliehene) Zigarre nicht mehr in der Lage ist, den Wurf der Keksdose zielsicher zu machen, dem Schreihals gelingt es nicht, Bloom in ernsthafte Gefahr zu bringen.
David W. Debney ermutigte mich, als ich Mitte zwanzig war, über Ulysses immer weiter nachzudenken und versprach mir, ich würde mit jedem neuen Lesen weitere Nuancen im Werk von Joyce und anderen Autoren mit Freude erkennen - der Anspruch, rasch alles begreifen zu müssen, verlor seine Einschüchterungskraft und verschaffte mir Zeit. Vielleicht werde ich später noch einmal darüber nachdenken, ob man das Glasperlenspiel mit Quidditch oder Snooker vergleichen kann. Über die Argumente von Pythagoras zur vegetarischen Ernährung oder die Quelle der Klitor bei Ovid wäre noch zu schreiben. Dem Grusel des Hauses der Krokodile und den versteckten Diamanten wäre noch ein Geheimnis zu entlocken, bestimmt auch der Abbildung der Hölle von Dante oder Odins Auge; Don Camillos Stimme im Ohr wäre nachzulauschen, die Rumpel- oder Besenkammer im Bürogebäude K.s wäre noch zu öffnen; der Bedeutung des so wichtigen Gedankens der Resilienz von Kindern wäre Aufmerksamkeit zu schenken; den Cucumber-Sandwiches Oscar Wildes wäre eine Zeile zu widmen; dem Wort "unverblümt" nachzusinnen, würde vielleicht mit einem Schmunzeln belohnt werden; mit Polonius im Arm Hamlets Perspektive des Wolkenbetrachtens einzunehmen oder eine rotierende Münze zu suchen, vielleicht war es auch ein glitzernder Ring, wäre ... wie auch die Würdigung der Idee des Gegenbildes zum Alltag ... wäre ... es wäre ein Versuch, Blumen zu pflanzen, wo nahrhafte Kartoffeln im Garten versprechen, Sättigung zu garantieren, bevor der Taugenichts zum Gärtner ernannt wird, und wo vieles einfach möglich wäre ... doch:
HERE ENDETH ... (Geoffrey Chaucer)
Fotos v.l.n.r.: Ein Arm im Schild mit trojanischem Bezug in der Glyptothek München; Ajax trägt den toten Achilles, Louvre Paris; Ithaka aus der NASA-Perspektive; der Selbstmord von Ajax, Louvre Paris - man muss etwas suchen, bis man den Sturz ins eigene Schwert erkennt; schließlich "Odysseus sinnend mit den Waffen Achills, staatliche Antikensammlung München, (alle auf Wikimedia Commons, public domain).